LEXIKON DER HEILPFLANZEN
Schnellzugang zu Heilpflanzenwissen – begleitend oder vertiefend.
Dieses Lexikon bietet einen kompakten Überblick über ausgewählte Heilpflanzen und ihre Eigenschaften. Im Mittelpunkt stehen das Wesen und die Signatur der Pflanze – ergänzt durch botanische Merkmale, Hinweise zur Anwendung und Informationen zu ihren Inhaltsstoffen.
Ein praktisches Nachschlagewerk für alle, die Heilpflanzen in ihrer Tiefe verstehen und sicher anwenden möchten.

ARTISCHOCKE
Cynara scolymus L.
WESEN: Selbstbeschränkung und Ausschweifung
Wesen und Signatur
Signatur
«Die Artischockenpflanze entwickelt eine massige Gestalt. Ihre Blätter sind weit ausladend, doppelt fiederschnittig geteilt und mit deutlichen Abständen zwischen den einzelnen Abschnitten. Der üppig vergrösserte Blütenkorb wird ausserordentlich schwer, und die zahlreichen Hüllblätter verschaffen ihm einen festen äusserlichen Halt. Sie sind innen fleischig und dienen – kurz vor der Blüte geerntet – als wertvolles Gemüse. Die Pflanze geht in jeder Hinsicht extrem in die Fülle und strotzt vor Saftigkeit. Das Blatt ist wässrig und von geringer Festigkeit. Ein Blattstück kann mühelos zwischen den Fingern zerrieben werden, es besitzt keine innere Struktur, die sich der Auflösung widersetzen könnte. Wenn man die Blätter bei der Ernte oder Verarbeitung kräftig anfasst, überziehen sich die Hände mit einer wachsartigen, zusammenziehenden Substanz. Es handelt sich dabei um die bitter schmeckenden Sesquiterpenlactone, die an der Oberfläche der Blattoberseite von Drüsenhaaren gebildet werden. Bei Regen können die Bitterstoffe leicht abgewaschen werden, da sie nur an der Blattaussenseite lokalisiert sind. Diese Stoffe wirken zusammenziehend und stehen somit in der Polarität zur auffälligen Üppigkeit der Pflanze. Die wachsartigen Bitterstoffe scheinen die Pflanze wie eine Schale von aussen zu umgeben und zu strukturieren. Die Artischocke bringt überschiessende Lebenskräfte zum Ausdruck, die von aussen gedämpft und strukturiert werden. Dieses begrenzende Prinzip, das von aussen auf das Wässrige im Innern der Pflanze wirkt, kommt in den Blüten besonders stark zum Ausdruck. Masslosigkeit erkennen wir in der sehr grossen und schweren Artischockenblüte, die aber durch den Mantel der zähen Hüllblätter begrenzt wird. Im Knospenstadium ist die Artischocke von den Hüllblättern vollständig umschlossen, und im Blütestadium bildet der Mantel nur eine geringe Öffnung als Raum für die feinen violetten Blütenhaare. Das Wesen der Pflanze, das eine strukturierende und formbildende Kraft hat, ist bei der Artischocke nicht bis ins Innere vorgedrungen. Es festigt und begrenzt den Körper vor allem von aussen, wie es im Tierreich z. B. bei einer Schnecke der Fall ist. In diesem Sinne ist die Artischocke die Schnecke unter den Pflanzen. Da sich das Wesen der Artischocke nicht so sehr mit der Materie verbunden hat, ist sein Beitrag als Wirkprinzip geringer als bei anderen Pflanzen. Andrerseits macht dieses eher schwach durchdringende Wesen die Artischocke gerade zu einem idealen Heilmittel bei Arteriosklerose. Bei dieser Krankheit erkennen wir ein Schwinden jugendlicher Lebenskräfte, worauf die strukturierenden Wesenskräfte des Menschen bis ins Innerste, bis in die Gefässe kristallisierend und verhärtend wirken. Man kann die Zubereitungen aus Artischockenblättern – regelmässig eingenommen – zu den besten Mitteln zur Vorbeugung gegen Arteriosklerose und zur Verzögerung von Alterungsprozessen bezeichnen.»
Wesen
«Das Wesen der Artischocke äußert sich in völlig gegensätzlichen Tendenzen. Einerseits bringt die Pflanze Üppigkeit und Fülle hervor, andererseits enthält sie ein Prinzip, das dieser Üppigkeit entgegenwirkt. In der Artischocke kommt das Gleichgewicht zwischen Ausschweifung und Selbstbeschränkung zum Ausdruck. Das Wesen dieser Pflanze unterstützt den Menschen im Bestreben, einen Ausgleich zwischen Maßlosigkeit und Verzicht zu finden. In der Annäherung an dieses Gleichgewicht können die Gedanken etwas von ihrer Schwere und Erdgerichtetheit verlieren und auf Höheres gerichtet werden. Durch ihre Bitterstoffe stärkt Cynara scolymus die Verdauungsvorgänge und stimuliert insbesondere die wirkungsvolle Umsetzung von Fetten.»
Botanik
Cynara scolymus L., die Artischocke, ist eine bis 2 m hohe distelartige Staude aus der Familie der Korbblütengewächse (Asteraceae). Aus ihrer Blattrosette treibt die Pflanze lange, oft unverzweigte Stängel, an deren Ende während des Sommers die kieferzapfen-ähnlichen Blütenstände gebildet werden. Die sehr massigen und grossen Laubblätter der Artischocke sind ein- bis zweifach fiederteilig, bisweilen sind sie auch ungeteilt. Sie werden bis 80 cm lang und 40 cm breit, sind an der Oberseite hellgrün und können vor allem im Jugendstadium weisslich behaart sein. Der Blattstiel ist sehr fleischig und geradezu wässrig. In den Monaten Juni bis Juli blüht die Artischocke mit den typischen, bis 15 cm grossen Blütenständen. Das, was wir als Artischocken-Blüte aus der Gemüseabteilung kennen, ist noch gar nicht die Blüte, sondern der nicht erblühte Blütenstand. Dieser entsteht in seiner charakteristischen Form durch einen fleischigen Blütenboden, der von einem stark ausgeprägten, eiförmigen Hüllkelch umschlossen wird. Die Blätter des Hüllkelches sind dachziegelartig angeordnet und weisen am Grunde ebenfalls fleischige Bereiche auf. Die röhrenförmigen und meist blauen Blüten erscheinen dann am Kopf des Blütenstandes. Die ganze Pflanze hat einen eigentümlichen, wachsartigen Geruch.
Verwendung
Die bitter schmeckende Artischocke ist fester Bestandteil der mediterranen Küche. Verzehrt werden die saftigen Hüllblätter und der fleischige Blütenboden. Eine weitere beliebte Form der Anwendung sind Frischpflanzenpresssäfte. Im pharmazeutischen Bereich werden Trockenextrakte und Tinkturen seit Jahrzehnten bei Verdauungsstörungen, chronische Leber-Galle-Störungen und Fettstoffwechselstörungen eingesetzt. Aufgrund des bitteren Geschmacks haben Artischockenpräparate eine anregende Wirkung auf die Produktion und den Abfluss der Galle (Cholerese) in den Verdauungstrakt. Dies wirkt sich insbesondere günstig auf die Fettverdauung aus und dyspeptische Beschwerden, wie Völlegefühl und Blähungen, werden gemindert. Daneben zählen arzneiliche Zubereitungen von Cynara scolymus L. zu wichtigsten pflanzlichen Heilmitteln bei Lipidstoffwechselstörungen, wie Hyperlipidämie. Zusammen mit den antioxidativen Eigenschaften erklärt dies auch den Einsatz der Artischocke im Bereich der präventiven Behandlung von Arteriosklerose.
Inhaltsstoffe
Cynara scolymus L. enthält pflanzliche Säuren wie z.B. Chlorogensäure, Flavonoide (Glykoside des Luteolins) und einen nicht zu vernachlässigenden Anteil an Sesquiterpenlactonen. Die Inhaltsstoffe der Artischocke haben einen leicht salzigen, kräftig bitteren Geschmack.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). European Union herbal monograph on Cynara cardunculus L. (syn. Cynara scolymus L.), folium. EMA/HMPC/194014/2017 (2018).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment report on Cynara cardunculus L. (syn. Cynara scolymus L.), folium. EMA/HMPC/194013/2017 (2018).
- BGA/BfArM (Kommission E). Cynarae folium (Artischockenblätter). Bundesanzeiger 122, (1988).
- BGA/BfArM (Kommission D). Cynara Scolymus. Bundesanzeiger 109 a, (1987).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.




BALDRIAN
Valeriana officinalis L.
WESEN: Erdung, Ableitung, Mutter Erde
Wesen und Signatur
Signatur
«Die Blüten des Baldrians entwickeln einen betörenden Duft. In einem blühenden Baldrianfeld mit seiner Spannungsgeladenheit durch Duft, Farbe und Form ist es kaum längere Zeit auszuhalten. Der Blütenstand ist eine Trugdolde, das heisst, er ist äusserlich ähnlich wie der Blütenstand von Doldengewächsen, obwohl er nicht so geordnet strukturiert ist wie dieser. Die Blütenfarbe ist weiss bis rosa und wirkt durchsichtig und leicht phosphoreszierend.
Nachdem der Baldrian verblüht ist, entstehen zur Fruchtzeit aus dem Kelch fedrig behaarte Borsten, die mit ihren filigranen, grauen Mustern das Bild der Pflanze prägen. Die Blätter sind gefiedert und haben tief schräg eingesägte Teilblätter. Das ganze Blatt vermittelt einen spannungsgeladenen, zerrissenen Eindruck wie von einem hochfrequenten, unregelmässigen Schwingungsmuster. Obwohl die Pflanze dekorativ ist, stellt sie wohl kaum jemand in einer Vase ins Wohnzimmer; dies nicht nur wegen des Dufts. Beim Pflücken knickt meistens der Stengel ab. Eigenartig, denn an seinem Standort ist der Baldrian recht standhaft. Aber offensichtlich verliert er seine Stabilität, wenn er abgeschnitten ist. Bei der Wurzel verändert sich der Charakter der Pflanze tiefgreifend. An einem daumendicken Rhizom hängen unzählige lange, dünne Wurzeln. Ausgegraben und gewaschen sieht die Wurzel wie ein langer, weisslicher Bart mit beinahe geraden Haaren aus. Die Wurzel beeindruckt durch ihre Fülle und ihren einfachen, parallelen Aufbau; Wurzel schmiegt sich an Wurzel. Der gesamte Wurzelstock ist – obwohl aus einer Vielzahl von Einzelwurzeln bestehend – ruhig und harmonisch. Man kann sich leicht vorstellen, wie fest der Baldrian mit seinen vielen Einzelwurzeln im Boden verankert ist und wie er diejenigen Energien zu erden und abzuleiten vermag, die in der Feingliedrigkeit und Spannungsgeladenheit der oberirdischen Pflanzenteile zum Ausdruck kommen. Am Geruch der Baldrianwurzeln, der noch intensiver als der Blütenduft, doch von ganz anderem Charakter ist, scheiden sich die Geister: Viele mögen ihn nicht leiden, doch dies ändert nichts daran, dass er meistens sehr tragend und beruhigend wirkt.
Eine Abhandlung über Baldrian wäre unvollständig, erwähnte man die grosse Vorliebe der Katzen für diese Pflanze nicht. Eine Baldrianpflanze, ins Freie gestellt, wird zum rege besuchten Anziehungspunkt für alle Katzen des Quartiers. Sie suhlen sich darin, versuchen ihn mit dem Kopf zu durchdringen, legen sich mit dem Rücken darauf und fressen davon (obwohl sie ansonsten alles Vegetarische verabscheuen). Katzen suchen bekannterweise im Gegensatz zu Hunden gerade diejenigen Orte auf, die durch Störfelder belastet und für den Menschen nicht zuträglich sind. Wir können ebenfalls feststellen, dass Katzen sich gerne zu Kranken ins Bett legen. Offensichtlich haben diese geschätzten Haustiere eine wichtige Funktion für den Menschen. Sie können Energien, die für den Menschen krank machend sind, assimilieren und ableiten. So haben wir eine energetische Symbiose zwischen Mensch und Katze, indem beide voneinander profitieren. Diese Beobachtungen bestätigen die bisherigen Erkenntnisse, dass Baldrianwurzeln einen energetisch ableitenden und abbauenden Charakter haben. Sie ziehen ein Übermass an Energie, die für die Sinnes- und Gedankentätigkeit benötigt wird, ab und bewirken so eine Besänftigung der nicht aufzuhaltenden, zehrenden Nerventätigkeit.»
Wesen
«Baldrian hat eine vermittelnde und ableitende Wesenskraft. Er leitet einen Überschuss an Nerven-Sinnes-Energie ab und erdet sie, er neutralisiert eine Überspannung an «Nervenelektrizität». Damit hilft Baldrian dem Menschentyp, der Gefahr läuft, den Boden unter den Füßen zu verlieren und zu schweben, der eine übersteigerte Gedankenaktivität mit Neigung zur Gedankenflucht entfaltet und eine Überempfindlichkeit der Sinne entwickelt. Solche Menschen haben oft etwas Durchsichtiges, Ätherisches. Durch seine erdende Wirkung stellt Baldrian das Gleichgewicht zwischen der Denk- und Sinnesaktivität und der Stoffwechselaktivität wieder her.
Die Schwierigkeit bei der Anwendung von Baldrian liegt darin, dass er eine ausgeprägte Polarität besitzt und bei gegensätzlichen Wesenszügen eingesetzt werden kann.
Grundsätzlich müssen Denken und Fühlen im richtigen Verhältnis zueinander, im Gleichgewicht stehen. Sind die Gefühle beherrschend, können keine strukturierten und vernünftigen Gedanken gefasst werden. Mangelt dem Denken jedoch die Durchwärmung durch das Herz, entstehen isolierte Denkprodukte, die nicht im Einklang mit den Lebensgesetzen der Natur und des Kosmos stehen und zu zerstörerischen Resultaten führen. Die Zerstörung kann dabei nach innen oder nach außen gerichtet sein. Nach innen entsteht eine übermäßige Zehrung der Lebenskräfte, eine Überreiztheit, Nervosität, Überempfindlichkeit. Dies entspricht dem oben beschriebenen Menschentyp. Die zerstörerischen Folgen des isolierten Denkens nach außen treten in unserer Zeit immer mehr zu Tage.
Dominieren die Gefühle, wird das Denken geschwächt; es läuft unkontrolliert, ausschweifend ab und kann nicht gezielt gehandhabt werden. Gefühle herrschen vor, nicht Sorgen. Gedanken machen sich selbstständig, sind aber Gefühlsgedanken, die um verletzte Gefühle, Lob und Tadel, Angenommensein oder Abgelehntwerden kreisen. Geschehnisse werden immer wieder durchdacht, eigentlich durchfühlt. Die Gedanken können nicht begrenzt werden, nicht beendet, schon gar nicht strukturiert. Eine innere Unruhe breitet sich aufgrund von Gefühlen aus.
Baldrian kann aufgrund seiner vermittelnden und erdenden Wesensart auch in solchen Situationen ausgleichend und sedierend wirken.»
Botanik
Valeriana officinalis L., der Echte Baldrian, ist eine zwei- bis mehrjährige Staude aus der Familie der Baldriangewächse (Valerianaceae). Seine unterirdischen Teile bestehen aus einem kurzen und walzenförmigen Wurzelstock an dem zusammengedrängt die Wurzel stehen. Diese können bis 30 cm lang werden und bilden reichlich feine Seitenwurzeln aus. Hierdurch entsteht ein sehr dichtes Wurzelgeflecht, welches die Pflanze sehr standfest im Boden verankert. Die unterirdischen Teile der Pflanze zeigen einen charakteristischen Geruch, den vor allem Katzen sehr mögen… Im ersten Vegetationsjahr treibt die Pflanze zunächst nur buschig stehende und unpaarig gefiederte Grundblätter aus. Zumeist erst im zweiten Jahr entstehen die Stängel mit den Blüten. An den senkrecht emporsteigenden, bis 150 cm hoch werdenden, Stängeln stehen die Blätter gegenständig. Auch sie sind unpaarig gefiedert, die Fiedern sind elliptisch bis schmal lanzettlich. An der Spitze trägt der Stängel den Blütenstand, die Blüten entstehen ab Mai bis in den August. Die Blüten selbst sind meist hellrosa gefärbt, sie können aber auch weiss sein und sie sind zu schirmförmigen Trugdolden vereinigt. Sie verströmen einen angenehmen Geruch. Ab August beginnen die Früchte heranzureifen, welche mit dem Wind verbreitet werden.
Verwendung
Bereits Hippokrates, die heilige Hildegard und auch Paracelsus kannten die Baldrianwurzel als wertvolle Arznei und noch heute ist der Baldrian eine der bekanntesten Heilpflanzen und Gegenstand intensiver Forschungstätigkeit. Auf dem Arzneimittelmarkt findet man zahlreiche Präparate, Tinkturen und Teedrogen. Die therapeutischen Hauptanwendungsgebiete von Baldrian sind Unruhezustände und nervös bedingte Einschlafstörungen. Patienten, die Baldrian einnehmen, berichten über eine verbesserte Schlafqualität und Verbesserung der Schlaf- und damit verbundenen Störungen wie z.B. das «restless leg syndrome» oder Angstzustände, sowie auch Verbesserungen bei Unruhezuständen u.a. auch im Beriech Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). In der Homöopathie gehören zudem auch Ischiasschmerzen – dumpfe, pochende und ausstrahlende Nervenschmerzen, die ruckartig beginnen können und sich auch in einer erhöhten Empfindlichkeit der Muskeln, Muskelkrämpfen und Taubheitsgefühlen äussern können – zu den Anwendungsgebieten. Beruhigende und schlaffördernde Pflanzen – Baldrian, Hafer, Hopfen, Johanniskraut, Lavendel, Melisse, Passionsblume und weitere – können helfen den Einsatz synthetischer und häufig nicht gleich gut verträglicher Schlafmedikamente (Antihistaminika, Benzodiazepine), zu verringern oder gar zu ersetzen.
Inhaltsstoffe
Der Baldrian, Valeriana officinalis L., enthält ätherisches Öl, das vor allem aus Mono- und Sesquiterpenen besteht. Weitere typische Inhaltsstoffe sind diverse Säuren wie Essigsäure, Valeriansäure, Isovaleriansäure und Myristicinsäure sowie deren Esterverbindungen.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Bent, A., Moore, D., Patterson, M. & Mehling, W. Valerian for sleep : A systematic Review. Am J Med 119, 1005–1012 (2015).
- Shinjyo, N., Waddell, G. & Green, J. Valerian Root in Treating Sleep Problems and Associated Disorders—A Systematic Review and Meta-Analysis. J. Evidence-Based Integr. Med. 25, 1–31 (2020).
- Anheyer, D., Lauche, R., Schumann, D., Dobos, G. & Cramer, H. Herbal medicines in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): A systematic review. Complement. Ther. Med. 30, 14–23 (2017).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). European Union herbal monograph on Valeriana officinalis L., radix. Eur. Med. Agency EMA/HMPC/1, (2016).
- BGA/BfArM (Kommission D). Valeriana officinalis (Valeriana). Bundesanzeiger 190a, (1985).
- BGA/BfArM (Kommission E). Valerianae radix (Baldrianwurzel). Bundesanzeiger 90, (1985).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2018).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.




BÄRLAUCH
Allium ursinum L.
WESEN: Expansionskraft, Dynamik, Macht, Einfachheit
Wesen und Signatur
Signatur
«Der Bärlauch ist ein einfacher Geselle. Man kann die Pflanze lange betrachten und nach irgendwelchen Besonderheiten in der Signatur suchen, man wird vorerst wohl kaum fündig. Die Pflanze hat einfache, lanzettliche Blätter, etwa 12 bis 20 cm lang und 3 bis 5 cm breit. Von oben betrachtet sind die Blätter sattgrün, von unten hellgrün. Die 4 bis 20 Blüten pro Pflanze sind zu einem doldenartigen Blütenstand zusammengefasst und sehen aus wie helle weisse Sterne mit sechs Zacken.
Beeindruckend am Bärlauch ist seine dichte und grossflächige Ausbreitung. Die Massenbestände bedecken im Frühling oft gewaltige Flächen von Laubwaldböden beinahe lückenlos und verbreiten einen intensiv durchdringenden, knoblauchartigen Geruch. Sein Geschmack ist sehr würzig, und die jungen Blätter ergeben eine beliebte Zugabe für Frühlingssalate. Wo der Bärlauch Fuss gefasst hat, bleibt für andere Frühlingspflanzen kaum mehr Raum. Kein anderes Kraut unserer Wälder hat eine dermassen flächendeckende vegetative Ausbreitungskraft, und kein anderer Duft ist dermassen dominierend wie der Bärlauchduft. Der Bärlauch hat also ein Erfolgsrezept. Worin besteht dies? Man könnte biochemische Erklärungen heranziehen wie diejenige, dass er bestimmte Substanzen ausscheidet, die das Wachstum anderer Pflanzen hemmen. Doch solche Antworten betreffen nur die Aussenseite der Dinge und werden dem Wesen nicht gerecht.
Immer wieder habe ich beobachtet, wie um Burgen und Ruinen der Bärlauch besonders prächtig gedeiht. Schon bevor ich es begründen konnte, spürte ich, dass das Wesen des Bärlauchs und das, was die Burgen einst verkörperten, etwas Gemeinsames haben. Worin mag die grosse Expansionskraft wohl begründet sein? Tauchen wir noch tiefer in die Signatur der Pflanze ein und betrachten wir ganz genau die Stelle nahe am Boden, wo die Blattstiele angewachsen sind. Wir bemerken, dass etwas mit der Pflanzengeometrie nicht ganz stimmt. Was uns als Blattoberseite erscheint, ist in Wirklichkeit die Unterseite. Der Bärlauch hat die Blattseiten verkehrt. Das kommt so: Die jungen Blätter streben steil nach oben. Ab einer gewissen Grösse kommt das schwerer werdende Blatt in eine überhängende Lage und wölbt sich nach hinten, so dass nun die Unterseite zur Aussenseite des Blattgewölbes wird. Im Bärlauch finden wir also eine Umkehr von Verhältnissen, es werden nicht die richtigen Seiten beachtet. Der Bärlauch breitet sich aus, indem seine Blätter in Wirklichkeit rückwärts gerichtet sind.
Wir fragten nach dem Erfolgsrezept, nun sind wir in der Lage, darauf eine Antwort zu geben. Beobachten wir Menschen, die zu grosser Macht gelangen, werden wir bei vielen feststellen, dass sie ihr Umfeld selektiv wahrnehmen. Sie schöpfen ihre Energie aus Vereinfachungen, indem sie gewisse Aspekte der Realität ausblenden. Das Gegenbeispiel dazu ist ein echter Philosoph, der nach der Wahrheit sucht. Sein Weltbild ist differenziert. Doch daraus würde er niemals die Kraft schöpfen können (abgesehen davon, dass er es gar nicht wollte), um zu Macht zu gelangen. Macht im äusserlichen Sinne (es gibt auch geistige Macht, die nichts damit zu tun hat) kann nur derjenige erlangen, der es mit der Wahrheit nicht immer genau nimmt, die Tatsachen (unbewusst oder bewusst) vereinfacht und damit oft umdeutet. Die ganze Energie wird zur Ausbreitung aufgewendet und nicht zur differenzierten Betrachtung der Realität. Es werden wechselnde Bündnisse geschlossen, je nach dem augenblicklichen Nutzen, ohne Rücksicht auf Gerechtigkeit und die Interessen anderer. Dass viele, die im Weg stehen, verdrängt und ungerecht behandelt werden, kümmert den Eroberer wenig, denn seine Expansionskraft und seine Erfolge geben ihm Recht und lassen ihn glauben, dass sie der Lohn für gerechte Taten seien. Obwohl vorwärts schreitend, ist seine Ausrichtung rückwärts gerichtet. An seinem breiten Rücken prallt alles ab. Und so fehlt ihm die Wahrnehmung für die Opfer, die er auf seinem Feldzug überrennt.
Trotzdem hat diese Wesensart auch positive Auswirkungen, denn sie ist ein Teilaspekt des praktischen Lebens, ohne den wir nicht auskommen. Die Vereinfachung und selektive Wahrnehmung ist in vielen Situationen angebracht. Wer immer nur eine absolut philosophische, differenzierte Betrachtungsweise anwendet, kommt bei vielen Aufgaben des praktischen Lebens nicht vom Fleck, weil alles ein Dafür und Dawider hat. Deshalb kann uns die Wesensart des Bärlauchs hilfreich sein, ohne dass wir darum befürchten müssen, zum Machtmenschen zu werden.»
Wesen
«Wenn der Bärlauch sich mit seinem intensiven Geruch im Frühling in den Wäldern ausbreitet, setzt er durch seine kraftvolle Gegenwart Siegeskräfte frei. Der Bärlauch ist ein äußerst machtvoller, durchdringender Frühlingsbote. Er besitzt eine ungeteilte Expansionskraft. Das Wesen dieser Pflanze symbolisiert einen Menschen, dessen Lebenskraft ganz in den Dienst der Ausbreitung und Machtentfaltung gestellt ist. Das Denken ist klar und einfach und primär auf das einmal gesetzte Ziel gerichtet. Was zur Erreichung dieses Ziels nützlich und praktisch ist, wird auch als richtig und wahr betrachtet. Obwohl der Wahrheit dabei manchmal Gewalt angetan wird und man einer komplexen Situation oft nicht gerecht wird, hat dies den Vorteil, dass die ganze Lebenskraft in eine fruchtbare Tatkraft umgesetzt werden kann und nicht durch ein zu stark differenzierendes Denken geschwächt wird. Das strukturierende Denken wird also der Lebenskraft untergeordnet. Es beschäftigt sich nicht mit der Frage nach dem, was an sich richtig ist, sondern mit dem, was nützlich und vorteilhaft ist.
Aus dieser Wesenskraft ergibt sich die große Heilkraft dieser Frühlingspflanze. Häufig dominieren beim modernen Menschen die strukturierenden Kräfte, und es kommt in der Folge davon zu sklerotischen Tendenzen im Gefäßsystem, zu Verhärtungen und Erstarrung von Gewebe und Gelenken. Der Bärlauch löst diese Tendenzen mit seiner durchdringenden Frühlingslebenskraft. Er versorgt die Blutzirkulation mit neuer Energie, regt die Willenskraft und den Tatendrang an. Bärlauch überwindet die durch Winter und Kälte symbolisierten Stauungs- und Verhärtungstendenzen in Körper und Seele.»
Botanik
Wer kennt ihn nicht, den Bärlauch (Allium ursinum L.), der zu den Liliengewächsen (Liliaceae) gehört? Er ist in Mitteleuropa heimisch und wächst gerne auf nährstoffreichen und mässig feuchten Böden in Laubwäldern. Dort tritt er flächendeckend und in großen Gruppen auf. Im Frühjahr treibt er aus einer Zwiebel seine 2 bis 3 elliptisch-lanzettlichen Laubblätter aus. Diese werden bis zu 20 cm lang. Die Blätter riechen stark und intensiv nach Knoblauch, so kann man einen Bärlauch-Bestand im Wald bereits aus der Ferne riechen. Bei seinen Blättern zeigt uns der Bärlauch etwas Besonderes: Das, was wir als Blattoberseite sehen, ist in Wahrheit die Blattunterseite und umgekehrt. Die Blätter des Bärlauches sind also gewendet! Ende April bis Mai schiebt sich dann ein unbeblätterter Stängel aus der Zwiebel, an dessen Spitze die weissen, sternförmigen Blüten erscheinen. Nach der Blühphase sterben die oberirdischen Teile der Pflanze rasch ab und treiben erst im nächsten Frühjahr aus der Zwiebel wieder aus.
Verwendung
Bärlauch, ist wahrscheinlich bereits seit Jahrtausenden als Lebensmittel und Medizin bekannt. Hinweise über die Verwendung des Bärlauchs findet man aus der Steinzeit, bei den alten Römern, beim griechischen Arzt Dioscorides, im Mittelalter und weiteren bekannten Kräuterkundigen wie Lonicerus. Seit langer Zeit wird der Bärlauch als magen- und blutreinigendes Mittel geschätzt. Ein typisches Anwendungsgebiet des Bärlauchs sowohl in der Homöopathie als auch in der Pflanzenheilkunde ist die Verdauungsschwäche. Des Weiteren findet der Bärlauch Gebrauch bei Erkrankungen der Atemwege und wird auch äußerlich unterstützend zur Wundheilung und Hautleiden eingesetzt. Die Verwendung des Bärlauchs in der Küche als Pesto und insbesondere als Frischpflanzensaft für Frühjahrskuren hat sich in der alpenländischen Volksmedizin bis heute durchgehend erhalten. Auch als Nahrungsergänzungsmittel ist der Bärlauch in heutiger Zeit erhältlich. Aus Sicht des Schweizer Kräuterpfarrers Johann Künzle ist der Bärlauch eine «der stärksten Medizinen». Lonicerus schreibt dem Bärlauch die gleichen Eigenschaften und Wirkungen wie dem Knoblauch zu, stufte den Bärlauch jedoch übergeordnet ein. Diese Sichtweise wird bis in die heutige Zeit hinein vertreten. Heute haben sich hauptsächlich zwei Anwendungsgebiete durchgesetzt. Zum einen dient Bärlauch als wertvolles Blutreinigungsmittel, was auch die begleitende Anwendung von Allium ursinum L. zur Vorbeugung von kardiovaskulären Erkrankungen und damit in Verbindung stehenden Beschwerden erklärt. Zum anderen wird Bärlauch als Reinigungsmittel für Magen und Darm genutzt.
Inhaltsstoffe
Bärlauch ist im Geruch dem Knoblauch sehr ähnlich. Hauptverantwortlich dafür sind die schwefelhaltigen Stoffe (z.B. Vinylsuflid). Des Weiteren findet man typischerweise phenolische Stoffe und Steroidglycoside.
Referenzen
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Sobolewska, D., Podolak, I. & Makowska-Wąs, J. Allium ursinum: botanical, phytochemical and pharmacological overview. Phytochem. Rev. 14, 81–97 (2015).
- BGA/BfArM (Kommission D). Allium ursinum. Bundesanzeiger 22a, (1988).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.




BIRKE
Betula pendula
WESEN: Qualität, Ästhetik, Polarität von Leben und Tod
Wesen und Signatur
Signatur
«Welches Kind kennt sie nicht, die Birke, den einzigen Baum mit weisser Rinde? Weiss ist die Farbe der Reinheit, der Unberührtheit, des Brautkleids. Es ist die Farbe der Verheissung, denn das weisse Licht kann sich teilen in die fundamentalen Farben des Regenbogens. Weiss ist keine seltene Farbe im Pflanzenreich, es gibt zahlreiche schöne weisse Blüten. Der Begriff blütenweiss gilt als Synonym für höchste Reinheit. In der weissen Blüte begegnet uns ein Bild verheissungsvollen jungen Lebens. Ansonsten finden wir die weisse Farbe vor allem in der unbelebten Natur, wie zum Beispiel im Schnee. Der Anblick einer frisch verschneiten Landschaft berührt uns feierlich. Wir spüren die Reinheit, Frische und Erneuerung, die von der sanften, im Sonnenschein glitzernden Schneedecke ausgehen. Doch es wäre ein voreiliger Schluss, das Wesen der Birke – wegen ihrer weissen Rinde – mit Reinheit zu bezeichnen. Bevor wir die Bedeutung der weissen Birkenrinde deuten können, müssen wir das Wesen der üblicherweise braunen Rinde verstehen. Wenn wir einen Apfel aufschneiden und an der Luft stehen lassen, verfärbt er sich braun; die lebensabbauenden Oxidationsprozesse ergreifen die verletzten Zellen an der Schnittstelle des Apfels. Braun begleitet im Pflanzenreich immer den Abbau. Die Rinde ist braun wie die Erde, der Humus und besteht aus abgebautem Pflanzenmaterial, das nicht mehr von den Lebenssäften durchströmt wird. Die Rinde hat also eine wesenhafte Verwandtschaft mit der Erde. Beide befinden sich auf dem Weg von lebendiger Substanz zu mineralischer Substanz. Heisst dies nun, dass die weisse Birkenrinde noch blütenhaft und nicht erdhaft abgebaut ist? Nein, im Gegenteil. Denn schreitet der Abbauprozess weiter, entsteht als letzte Stufe das Mineral, die reine weisse Asche. In der Birke sehen wir einen Baum, dessen Rinde die vollständige Auflösung des Lebendigen symbolisiert, den Tod. Damit kommen wir zu der anderen Bedeutung von Weiss, wie sie vor allem in östlichen Kulturen erkannt wird, als Farbe der Trauer und des Todes. Jetzt erst haben wir ein vollständiges Bild dieser Farbe, denn in ihr liegt die Polarität des Anfangs und des Endes des Lebenskreises, der Verheissung des Lebens und des Todes. Scheinbar ferne Gegensätze liegen in Wirklichkeit nahe beieinander, denn sie werden durch die immerwährende Bewegung des Lebens zum Kreis geschlossen. Zwischen diesen Polen – beide symbolisiert durch Weiss – spannt sich die Lebenskraft, die uns bewegt. Das Wesen der lebendig kreisenden Bewegung ist es also, was uns in der Birkenrinde symbolhaft begegnet. Leben heisst Bewegung, Veränderung, Flexibilität. Die Birke ist ein äusserst beweglicher Baum. Besonders bei der Hängebirke – welche die arzneilich verwendeten Blätter liefert – sehen wir eine tänzerische Anmut der Bewegung, wenn der Wind durch ihre Zweige fährt. Die Zweige sind fein und elastisch, deshalb bedient man sich ihrer auch zur Herstellung von Reisbesen und Ruten. Im Frühling sind die Birken reich durchströmt von einem Überfluss an lebenserweckendem Saft, der oft zur Entschlackungskur getrunken wird. (Das zu diesem Zweck erforderliche Anzapfen der Birken sollte nur von Fachleuten vorgenommen werden, um den Baum nicht zu schädigen.) Die Birkenblätter verbreiten einen besonders lieblichen, süsslichen Duft, der unsere Seele mit Verjüngungskräften durchströmt.»
Wesen
«Die Birke vereint in sich die Gegensätze von Leben und Tod. Sie trägt Zeichen jung strömenden Lebens ebenso wie solche des Abbaus und der Mineralisierung. Wie ist es der Birke möglich, eine solch große Spannweite zu umfassen? Sie wurde in den Mythen oft als anmutig tanzende Jungfrau mit goldenem Haar dargestellt (Betula bedeutet hebräisch junges Mädchen). In der geschmeidigen Bewegung der Zweige im Wind, im goldgelben Frühlings- und Herbstkleid und in der reinweißen Rinde können wir diesen Vergleich nachempfinden. Tanz ist Rhythmus, Schwingung, Vibration. Anmutiger Tanz, ästhetische Gestalt, Ausstrahlung ist ein Bildnis von reiner Qualität, von Seelenkraft, die alle Gegensätze vereint. Es ist das seelische Prinzip, welches das Geistige mit der Materie verbindet, das Tote zum Leben erweckt und zwischen den größten Polaritäten vermittelt. Das Wesen der Birke ist Qualität. Unter dem Einfluss dieses Baumes empfindet die Seele Farben leuchtender, Töne klangvoller, Düfte aromatischer. In seinem Wirkungsbereich erscheinen Gestalten lebendiger, unsere Sinne werden befähigt, Ästhetik und Harmonie zu erschauen. Birkenblättertinktur ist das angezeigte Mittel, wenn die Welt als matt und grau empfunden wird, wenn man von Kräften der Erstarrung und Kälte zu sehr umklammert wird. Lässt der jugendliche Schwung in den Gedanken und Gefühlen nach, geht die Freude an der körperlichen Bewegung verloren, dient die Birke als reich fließender Quell neuer Kräfte. Die Birke erreicht aber auch den gegensätzlichen Menschentyp, der zu leichtfüßig, zu tänzerisch durchs Leben geht. Den Menschen, dem das Leben eine Bühne zur Selbstdarstellung ist, der tiefe Bindungen scheut, der wie ein Schmetterling nach der Süße des Lebens hascht und dessen herbe Seiten verdrängt. Durch sein unverbindliches Verhalten hat er keinen tiefen Anteil am gemeinschaftlichen Band der Freundschaft und des Interesses, das die Menschen verbindet. Verbindung und Freundschaft wird im Organsystem von den Nieren repräsentiert. In der Aktivierung der Nierentätigkeit durch Betula erhalten solche Menschen die Möglichkeit, sich tiefer mit dem Leben und den Menschen zu verbinden.»
Botanik
Die Hängebirke (Betula pendula Roth) (Familie: Betulaceae Birkengewächse) ist ein Baum, der bis zu 30 m hoch werden kann. Birken sind sehr raschwüchsig und stellen oft die ersten Bäume die einen Landstrich besiedeln. So hat die Birke als einer der ersten Bäume nach den Eiszeiten Mitteleuropa wieder besiedelt. Heute kommt sie bevorzugt an Ufern von Gewässern, in Mooren und als Bestandteil von feuchten Wäldern vor. Ihr Stamm wird im Frühjahr intensiv von Säften durchströmt. Die Rinde junger Bäume ist schneeweiß und schält sich in horizontalen Streifen ab. Bei den älteren Bäumen weist vor allem der untere Stammteil eine rissige und wulstige Rinde auf, weiter oben ist sie hingegen glatt und weiß oder gelblichweiß. Die Äste der Birke stehen spitz winklig ab und sind stark überhängend. Die jüngsten Triebe weisen oft zahlreiche Harzdrüsen auf. Ihre Blätter sind im Umriss 3-eckig mit lang ausgezogener Spitze. Anfangs sind die Blätter sehr weich, dicht drüsig punktiert und klebrig. Hängebirken blühen in den Monaten April bis Mai mit kätzchenartigen Blütenständen, jedes Kätzchen kann mehrere Millionen Pollenkörner produzieren, die sehr weit verbreitet werden können. Eine Altbirke produziert auch mehrere Millionen Samen, die aber nur sehr kurzlebig sind. Die Birke vereint so überquellendes Leben und den Tod.
Verwendung
Die Blätter der Birke werden in der Pharmazie frisch oder getrocknet in Form von Kräutertees, pulverisiert oder zur Herstellung von Trocken- oder Fluidextrakten verwendet. Der Schwerpunkt der Wirkung der Birkenblätter liegt vorrangig auf einer Steigerung der Diurese bzw. Aquarese. Deshalb eignen sie sich auch für die Durchspülungstherapie bei bakteriellen und entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege. Die Steigerung der Nierenleistung in Kombination mit ausreichender Flüssigkeitszufuhr kann auch dabei helfen, die Bildung von Nierengriess zu vermeiden. In der naturheilkundlichen Fachliteratur werden Arzneizubereitungen aus Hängebirke „Folia Betulae“ auch zur begleitenden Behandlung von rheumatischen Beschwerden und Hauterkrankungen empfohlen. Dies verwundert nicht, da gerade eine Ausscheidungsschwäche der Niere bei den vorgenannten Krankheitsbildern vielfach eine Mitursache darstellt.
Inhaltsstoffe
Typische Inhaltsstoffe von Betula pendula Roth sind Flavonoide, wie Hyperosid oder Glykoside des Quercetins. Darüber hinaus sind Triterpenester, Phenolcarbonsäure und Ascorbinsäure enthalten. Auch Mineralien sind nachweisbar, darunter vor allem Kaliumtartrat. In den Birkenblättern finden sich auch kleine Mengen ätherischen Öls.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). European Union herbal monograph on Betula pendula Roth and/or Betula pubescens Ehrh. as well as hybrids of both species, folium. EMA/HMPC/5, (2014).
- BGA/BfArM (Kommission E). Betulae folium ( Birkenblätter ). Bundesanzeiger 50, (1986).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil




BRENNNESSEL
Urtica dioica L.
WESEN: Aggression, Wille, Selbstüberwindung, Blutreinigung, Eisen
Wesen und Signatur
Signatur
«Auf Spaziergängen oder im Garten werden wir gelegentlich von der Brennnessel überrascht und erfahren dabei ihre heftig brennende Wirkung. Eine Pflanze, die brennt, ist eine ungewöhnliche Erscheinung, und die Brennnessel bildet denn auch in dieser Hinsicht eine Ausnahme. Schmerzlich spürbares Hauptmerkmal der Pflanze sind die typischen Brennhaare, deren kugelförmige Spitze bei der leisesten Berührung abbricht. Dabei entsteht eine scharfkantige Kanüle, aus der das Gift in die geritzte Haut fliesst, was zu Brennen, Juckreiz, Quaddelbildung und Rötung führt. Das Gift besteht aus Stoffen, die sonst vor allem im Tierreich vorkommen (Acetylcholin, Serotonin, Ameisensäure).
Die Brennnesseln besiedeln übersäuerte, mit Stickstoff überdüngte Böden, und man trifft sie daher häufig um Alphütten, an Waldrändern und auf Schutthalden an. Sie erfüllen für diese Böden eine wichtige Funktion, indem sie ihnen den überschüssigen Stickstoff entziehen und damit das biologische Gleichgewicht wieder herstellen.
Der aus dem Boden aufgenommene Stickstoff wird in der Pflanze in Eiweissverbindungen umgewandelt. Der hohe Eiweissgehalt macht die Brennnessel zu einer attraktiven Futterpflanze für Raupen und andere Insekten. Die Raupen vieler bunter Schmetterlinge (Tagpfauenauge, kleiner Fuchs, Admiral) sind von dieser Futterpflanze abhängig. Brennnesseln sind manchmal derart dicht mit Raupen besiedelt, dass sie von diesen bis auf den Stengel kahlgefressen werden. Eine andere Folge des Eiweissreichtums ist der rasch eintretende Zersetzungs- und Fäulnisprozess, wenn man sie in Wasser einlegt, um eine Jauche zu bereiten. Brennnesseljauche ist ein wirksamer und beliebter Flüssigdünger im biologischen Gartenbau. Ein dichter Brennnesselbestand entwickelt an heissen, sonnigen Sommertagen einen kräftigen, herb würzigen Duft, dem eine Wesensverwandtschaft mit Tiergeruch nicht abgesprochen werden kann. Keine andere Pflanze besitzt eine derart ausgeprägte Beziehung zum Eisen. Die Brennnessel hat eine hohe Selektivität für das Metall und reguliert auf diese Weise Böden mit zu hohem Eisengehalt. Deponien und Schutthalden mit Alteisen sind denn auch beliebte Brennnesselstandorte.
Während ein hoher Eisengehalt sich nur bei wenigen Pflanzen findet, da Eisen in der Biochemie der Pflanzen keine spezifischen Funktionen besitzt, erfüllt es bei Mensch und Tier eine wichtige Funktion. Als Zentralatom des Häms, des roten Blutfarbstoffs, ermöglicht das Eisen die Bindung des Sauerstoffs im Blut, so dass dieser zu seinem Bestimmungsort in den Zellen transportiert werden kann. Damit ist das Eisen verantwortlich für eine der wichtigsten Aufgaben des Bluts, den Sauerstofftransport. Eisen kann deshalb als zentraler Funktionsträger in der Atmung bezeichnet werden, und es bildet die Basis für die Verbrennung der Nährstoffe.
Gewissermassen als Ausgleich zu dem im Pflanzenreich untypisch hohen Eisengehalt besitzt die Brennnessel einen hohen Chlorophyllgehalt. Chlorophyll, der grüne Pflanzenfarbstoff, ist das chemische, optische und funktionelle Spiegelbild zum Häm. Beide Verbindungen haben eine sehr ähnliche chemische Struktur mit dem Unterschied, dass Häm als Zentralatom ein Eisenion und Chlorophyll ein Magnesiumion besitzt. Im Weiteren ist erwähnenswert, dass sich die beiden Farben Grün und Rot spiegelbildlich verhalten. Sie sind Komplementärfarben. Die Funktion von Chlorophyll ist die Assimilation von Lichtenergie und deren Umwandlung in chemische Energie, die benötigt wird, um aus Wasser und Kohlendioxid Glucose aufzubauen und Sauerstoff freizusetzen. Glucose ist die Ausgangssubstanz für die Bildung sämtlicher weiterer energiereicher organischer Verbindungen. Chlorophyll bildet somit die Grundvoraussetzung für die Aufnahme der Sonnenenergie, deren Speicherung in Biomasse und der Freisetzung von Sauerstoff. Demgegenüber ermöglicht Hämoglobin die Aufnahme von Sauerstoff als Voraussetzung für die Verbrennung von Nährstoffen (Biomasse) zu Kohlendioxid und Wasser unter Freisetzung der gespeicherten Energie. Die Energie wird für Muskelkraft oder die zahllosen physiologischen Reaktionen verwendet, wobei als wesentliches Nebenprodukt Wärme frei wird. Man kann deshalb sagen, dass am Beginn der langen Reaktionskette, die unsere Blutswärme ermöglicht, das Eisen steht.
Die Blattgestalt der Pflanze enthält keine auffälligen Züge. Die Blätter sind scharf gezähnt, kreuzweise gegenständig und sehr regelmässig, rhythmisch am vierkantigen Stengel angeordnet. Zahlreiche andere Pflanzen, wie zum Beispiel die Taubnesselarten, besitzen ähnliche Blätter, obwohl sie einer ganz anderen Familie angehören. Allein die Blüten geben der Brennnessel einen unverwechselbaren äusseren Charakter. Die Blüten – es gibt männliche und weibliche, die getrennt, auf verschiedenen Pflanzen vorkommen – sind farblos und sehr klein, aber durch ihre grosse Anzahl prägen sie das Aussehen der Brennnessel vom Hochsommer bis in den Herbst. Wie helle, schmale Würstchen oder Raupen stehen sie vom Stengel ab und verleihen dem Blütenstand dadurch einen tierhaften Charakter.
An der Brennnessel können wir somit einige für Pflanzen untypische Merkmale erkennen, die sonst nur im Tierreich auftreten. Dies bedeutet, dass in ihrem Wesen gerade diejenigen Elemente hervortreten, die das Tierreich vom Pflanzenreich unterscheiden, das heisst die innere Triebkraft zur Bewegung und Veränderung im umfassendsten Sinn. Auf den Menschen bezogen sind dies Wille und Durchsetzungskraft.»
Wesen
«Aggression wird meistens mit einer negativen, zerstörerischen Aktivität in Verbindung gebracht. Doch Aggression, im ursprünglichen, positiven Sinn verstanden, beseitigt Hindernisse, damit sich neue Aktivität entfalten kann (lat. aggredi, etwas angehen). Sie entfernt das Alte, Verbrauchte, Kraftlose, Überfällige und schafft dadurch Raum für Neues. Aggression und schöpferische Tätigkeit gehören untrennbar zusammen.
Für die persönliche Entwicklung und Freiheit ist es wichtig, eine positive, das eigene Wesen anpackende Aggression in der Form von Selbstüberwindung und Wille zu entwickeln, um die Führung im eigenen Leben zu übernehmen und sich nicht durch Triebe beherrschen zu lassen. Fehlt der zügelnde Wille, können behindernde Neigungen und Bindungen nicht losgelassen werden, was zur Ansammlung von seelischen und körperlichen «Schlacken» führt. Auf der Körperebene häufen sich aufgrund einer Fehlernährung (üppig, eiweißreich) Schlacken (stickstoffhaltige Abbauprodukte, Harnsäure) im Blut an, und es kommt dadurch zu einer Einschränkung der Bewegungsfreiheit (rheumatische und gichtartige Beschwerden). Hier hilft die Brennnessel mit ihrer Aggression, indem sie die Möglichkeit schafft, erstarrte Strukturen in Seele und Körper dynamisch aufzubrechen. Aufgrund ihres Eisengehalts besitzt sie eine spezifische Beziehung zum Blut. Es ist die ins Blut getragene Aggression, die den Organismus von den alten, unbrauchbaren Stoffen befreit. Bei keiner anderen Pflanze ist der alte Begriff «Blutreinigung» derart zutreffend wie bei der Brennnessel.
Brennnessel ist ein hervorragendes Basistherapeutikum zur Behandlung von Allergien. Allergien sind überschießende Immunreaktionen auf an sich unschädliche Substanzen. Sie sind Ausdruck einer Abwehr, die auf einen vermeintlichen Feind gerichtet ist, Zeichen einer fehlgeleiteten Aggression. Das Wesen der Brennnessel kann die Abwehr wieder ins richtige Verhältnis rücken.»
Botanik
Wer kennt sie nicht, die Brennnessel (Urtica dioica L.)? Bis zu 2.50 m kann sie gross werden und begegnet uns gerne an mit Stickstoff belasteten Standorten, wie Ufern, Gräben, Wegen und Kulturland. An ihren Stängeln stehen kreuzgegenständig ihre zugespitzten Laubblätter mit ihrem grob gesägten Rand. Stängel und Blätter der Pflanzen sind mit Brennhaaren besetzt, welche wie eine Kanüle geformt sind und ihren brennenden Saft in die Haut desjenigen injizieren, welcher die Pflanze unachtsam berührt. Die Brennnessel weiss sich zu wehren! Mit ihren unterirdischen Ausläufern erobert sie gerne den Raum um sich herum, so dass sie sich immer weiter ausbreitet, wenn ihr die Bedingungen am Ort behagen. Ab Juli etwa beginnen die Pflanzen zu blühen. Es gibt weibliche und männliche Brennnesseln, die beiden Geschlechter sind aufgrund ihrer kleinen, und vor allem unscheinbaren, Blüten für den Laien oft nur schwer zu unterscheiden. Bei den männlichen Blüten lässt sich bei genauer Betrachtung etwas Spannendes beobachten. Ihre Staubblätter sind regelrecht in der Blüte verspannt wie in einem Katapult. Reift der Pollen heran erhöht sich, gerade bei warmem und trockenem Wetter diese Spannung immer mehr, bis sie sich in einem explosionsartigen Stäuben der männlichen Blüten entlädt. Nimmt man sich die Zeit, so kann man bei den männlichen Pflanzen kleine Pollenwolken entweichen sehen, die mit dem Wind auf die Reise gehen.
Verwendung
Die Brennnessel zählt zu den Heilpflanzen, die schon besonders lange in der Phytotherapie angewendet werden. Sie war schon zu Zeiten von Hippokrates bekannt und wird auch von der heiligen Hildegard und Paracelsus empfohlen. Pflanzenheilkundlich zählt die Durchspülung bei entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege zu den Hauptanwendungsgebieten. Die über die Niere ausleitende Wirkung der Brennnessel kann auch zur Vorbeugung von Nierengriess genutzt werden. Eine weitere traditionelle Anwendung ist die unterstützende Behandlung von rheumatischen Beschwerden und leichten Gelenkschmerzen, die aus naturheilkundlicher Sicht zumeist auf das Vorliegen einer harnsauren Diathese zurückgeführt werden können. Bei seborrhoischen Hauterkrankungen werden Zubereitungen aus Brennnessel ebenfalls traditionell eingesetzt. Zudem verwundert es nicht, dass zumindest die der Urtica dioica L. nahe verwandte Urtica urens nach klassischem Homöopathieleitsatz «Similia similibus curentur» bei nesselsuchtartigen Hauterkrankungen, sowie aber auch bei Nierenleiden und Gicht eingesetzt wird. Eine wichtige volksmedizinische Anwendung von Urtica dioica L. ist die Reinigung und die Kräftigung des Blutes.
Inhaltsstoffe
Die kräftig grüne Brennnessel, Urtica dioica L., ist reich an Chlorophyll, Carotinoiden und Vitaminen (C, B, K1). Aus der Gruppe der Mineralien sind vor allem Calcium, Kalium und Kieselsäure enthalten. Neben der Ameisensäure finden sich im Bereich der Brennhaare zusätzlich Amine wie Histamin, Serotonin und Cholin.
Referenzen
- BGA/BfArM (Kommission E). Monographie: Urticae herba (Brennnesselkraut); Urticae folium (Brennnesselblätter). Bundesanzeiger 76, (1987).
- Wichtl, M. et al. Teedrogen und Phytopharmaka. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 1997).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Kommittee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Community herbal monograph on Urtica dioica L. and Urtica urens L., herba. EMEA/ HMPC/170261/2006 (2008).
- BGA/BfArM (Kommission D). Urtica dioica. Bundesanzeiger 199a, (1989).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil




EFEU
Hedera helix L.
WESEN: Selbsterkenntnis, Überwindung von Angst, Anklammerung und Freiheit, Verbindung von Unterbewusstsein und Bewusstsein, Bewusstwerdung der Schatten, Aufbrechen von verhärteten Strukturen
Wesen und Signatur
Signatur
«Der Efeu ist eine der grössten Mysterienpflanzen. Die Triebe des jungen Efeus mit den typischen fünflappigen Blättern kriechen durch feuchte, schattige Gründe und bedecken manchmal grössere Flächen des Waldbodens. Stellen sich ein Baum oder eine Mauer in den Weg, klammert sich der Trieb mit seinen Haftwurzeln daran fest und steigt empor zum Licht. Nach vielen Jahren – der untere Teil des Stamms ist jetzt dicht überdeckt mit Efeublättern – verzweigen sich die Seitentriebe. Sie streben weg vom stützenden Stamm und benötigen keine Haftwurzeln mehr. Nun kommt das Erstaunliche: Die Blätter der Seitentriebe sind anders geformt als die am Baum anliegenden Blätter. Viele Laien erkennen sie nicht als Efeublätter, obwohl sie bei einem mächtigen, baumumklammernden Efeu den Hauptanteil ausmachen. Sie sind nicht gelappt, sondern ungeteilt eiförmig. Man nennt die gelappten Blätter die juvenilen, die eiförmigen die adulten Blätter. Das heisst: Der Efeu hat Jugend- und Erwachsenenblätter mit verschiedenen Formen. Beide Blattformen sind lederartig, zäh und überdauern den Winter. Manchmal scheint ein Baum im Winter Blätter zu haben; es ist jedoch ein Efeu, der Stamm und Äste bis zur Krone umklammert. An den adulten Seitentrieben beginnen sich doldenartige Blütenstände zu entwickeln, die im Oktober erblühen und den Bienen einen letzten Nektar anbieten. Über den Winter entwickeln sich langsam die Früchte, die bis zum Frühling zu schwarzen Beeren heranreifen. Erwähnt sei noch ein wichtiger Inhaltsstoff: Efeu ist sehr reich an Jod, was sonst bei Landpflanzen unüblich ist und nur bei Meerespflanzen vorkommt. Der Efeu gehört zur Familie der Araliaceae, einer Pflanzenfamilie, die mit ihren Arten vor allem die Südhalbkugel der Erde besiedelt. Beginnen wir nochmals von vorne: Zuerst stellen wir also die juvenilen Triebe mit ihren Blättern fest, die wie fünfzackige Sterne aussehen. Nun machen wir ein Experiment. Wir nehmen einen jungen Efeutrieb und den Trieb einer beliebigen anderen Pflanze und setzen sie an einem beschatteten Standort direkt nebeneinander in die Erde. Was geschieht? Der Trieb jeder anderen Pflanze wächst zum Licht, der Efeu jedoch wächst in die entgegengesetzte Richtung, in den Schatten. Der Efeu strebt ins Dunkel des Waldes hinein. Wenn sich ihm ein Hindernis entgegenstellt und er daran emporsteigen muss, zeigen die fünfzackigen Blattsterne alle mit ihren Spitzen nach unten. Welch vielsagendes Symbol der Schattenwelt! Wenn der Efeu schliesslich nach Jahren auf seinem Weg im Zeichen des Schattens die höchsten Wipfel erreicht, so trägt er das Wesen des Schattens ans Licht. Es ist die Ausrichtung ins Dunkel, die den Efeu kennzeichnet, und es ist das Licht, das er erreicht. Dies steht nicht im Widerspruch zu den geistigen Gesetzen. Ganz ist nur derjenige, der die beiden Welten miteinander verbinden kann. Wer den Schatten flieht, wird sich nicht zum Licht erheben können, denn der Schatten wird ihn immer verfolgen und einholen. Die tiefen Gründe der Schatten, des Unterbewussten, müssen durchdrungen werden mit dem Licht der Selbsterkenntnis. Und hier sehen wir die tiefgründige Bedeutung des hohen Jodgehalts des Efeus. Jod ist das essenzielle Element für die Funktion der Schilddrüse. Dieses wichtige Organ bestimmt unser Wachstum und unsere Intelligenz. Ohne Schilddrüse wären wir dumpfe, unbewusste Wesen, bar jeglicher Fähigkeit zur geistigen Bewusstwerdung. Eine schwere Schilddrüsenunterfunktion führt zum so genannten Kretinismus (Zwergwuchs und zurückgebliebene geistige Entwicklung). Die Bewusstsein ermöglichende Wärme des Jods muss am Tor zur Schattenwelt erblühen (wie der Efeu im Herbst, am Tor zum Winter erblüht) und in der Kälte und Dunkelheit des Winters seine geistigen Früchte heranreifen lassen. Dem Efeu geht es nicht um die Pflege der Schatten, das Ausleben der niederen Triebe, sondern um ihr bewusstes Anschauen und Erkennen als Teil seiner selbst. Das ist etwas ganz anderes, als was die meisten Menschen spontan machen, nämlich vor den Schatten zurückweichen und sie verdrängen. Der Efeu versinnbildlicht die Verbindung zweier Welten; es ist eine Pflanze mit zwei Blattformen, den nach unten gerichteten Blättern der Unterwelt und den ganzen, eiförmigen Blättern der Lichtsphäre. So steigt der Efeu aus dem Süden bzw. dem Wasser (Symbole für das Unterbewusste) hinauf in den Norden bzw. das Land (Symbole für das Bewusste), beladen mit den Früchten der Selbsterkenntnis. Wer diesen Weg nicht geht – und dies trifft auf uns alle immer wieder in verschiedenen Phasen unseres Lebens zu –, wer den Weg zum Licht ohne die Durchdringung der Schatten gehen will, wird eingeholt von den Schemen der Angst, die ihn würgen wie der Efeu den Wirtsbaum. Eine wesenhafte Arznei aus den Efeublättern ist eines der grössten Heilmittel bei Übergangssituationen der seelisch-geistigen Entwicklung des Menschen.»
Wesen
«Die Wahrnehmung der inneren Bilder, Kräfte und Eigenschaften, die aus der Tiefe des Unterbewussten ins Bewusstsein aufsteigen, hat eine Schlüsselfunktion in der Seelenentwicklung des Menschen. Diese im Dunkel der Seelentiefe verborgenen Bilder, die oft als bedrohliche Schatten erscheinen, gehören ebenso zu unserer Ganzheit wie die uns bewussten und akzeptierten Eigenschaften. Der Bewusstwerdungsprozess ist oft mit existenziellen Problemen verbunden, da man sich vor den Schatten meist fürchtet und sie darum abweist und verdrängt. Die unbewusste Angst führt zur Enge in Seele und Körper. So wie Angst das »freie Atmen« der Seele einschränkt, führt sie auf der Körperebene zur Behinderung der Atmung in der Form von Symptomen wie Krampfhusten, Bronchitis oder Asthma. Das Wesen des Efeus ist die Verbindung des im Dunkeln liegenden Pols des Unbewussten mit dem sich im Licht befindlichen Pol des Bewussten. Schlüsselorgan für diese Verbindung ist die Schilddrüse, deren Funktion durch Efeu angeregt wird. Efeu löst psychisch bedingte Krampfzustände der Atmungsorgane und befreit die Atmung.»
Botanik
Der Efeu, (Hedera helix L.), ist mit seinen immergrünen Haftwurzeln fast jedem Kind bekannt. Als Holzpflanze gehört zur Familie der Araliaceae, die eigentlich mehr in den Tropen beheimatet ist. Der Efeu zeigt uns einige spannende Besonderheiten. Dies beginnt bereits bei den jungen Efeutrieben, die uns am Boden begegnen. Diese wachsen zunächst gezielt zum Schatten hin. Dies ist aussergwöhnlich, die meisten Pflanzen fühlen sich doch vom Licht angezogen. Erst wenn die Triebe des Efeus an einem Objekt angelangt sind, an dem diese nach oben klettern können, beginnen sie mit ihren Haftwurzeln auch zum Licht hin, also nach oben zu wachsen. Die Blätter des Efeus sind ledrig und wintergrün, oberseits dunkelgrün und glänzend. Es gibt zwei verschiedene Formen. Die Blätter des kletternden Jugendstadiums sind ganz anders geformt (fünflappig) als die Blätter, die der Efeu bildet, wenn er das Licht erreicht hat und aufhört zu klettern. Hier bildet die Pflanze die typischen eiförmigen Blätter des «Erwachsenenstadiums» und erst im Licht beginnt sie auch, mit typischen halbkugeligen Dolden und unscheinbaren gelbgrünen Blüten zu blühen. Diese Blüte findet im Herbst statt; da viel Nektar gebildet wird, herrscht ein reger Besuch von Insekten. Seine dunklen Früchte, die sich nach der Bestäubung entwickeln, reifen dann erst im Winter heran. Der Efeu ist im Übrigen kein «Schmarotzer», er dringt nicht mit seinen Wurzeln in andere Pflanzen ein und «stiehlt» ihnen Wasser und Nährstoffe. Trotzdem kann Efeu durch sein hohes Gewicht oder die Beschattung seinen Träger schädigen.
Verwendung
Der Efeu, Hedera helix L., spielte in Form von Kränzen bereits im klassischen Altertum eine kultische Rolle und wurde auch für ornamentale Darstellungen häufig genutzt. In den Schriften von Hippokrates wird der Efeu an vielen Stellen erwähnt. Hedera helix L. gilt als klassisches Husten- und Atemwegsmittel mit spasmolytischer, antitussiver und expektorierender Wirkung. Der Efeu wurde vor allem als reinigendes und auflösendes Mittel bei chronischen Katarrhen eingesetzt. Dies gilt insbesondere in Fällen mit starker Verschleimung. Der Efeu wird heute pflanzenheilkundlich und homöopathisch als hilfreiches Mittel bei produktivem Husten resp. akuten Entzündungen der Atemwege eingesetzt. Man findet den Efeu in verschiedenen Arzneimitteln in Form eines Tees, als Sirup, als konzentrierten Spezial-Extrakt in verschiedenen Darreichungsformen oder als (Ur-) Tinktur.
Inhaltsstoffe
Charakteristisch für den Efeu, Hedera helix L., sind Triterpensaponine (z.B. Glykoside des Hederagenins). Des Weiteren findet man ätherisches Öl, Flavonoidglykoside, Phenolcarbonsäuren und Polyacetylene.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- BGA/BfArM (Kommission E). Hederae helicis folium (Efeublätter). Bundesanzeiger 122, 2020 (1988).
- Hänsel, R., Keller, K., Rimpler, H. & Schneider, G. Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis Band 5 Drogen E-O. (Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1993, 1993).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). European Union herbal monograph on Hedera helix L., folium. EMA/HMPC/325716/2017 (2017).
- BGA/BfArM (Kommission D). Hedera Helix. Bundesanzeiger 29a, (1986).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.




ESCHE
Fraxinus excelsior L.
WESEN: Spannkraft, Ausdauer, Duldsamkeit, Tragfähigkeit, Zielgerichtetheit
Wesen und Signatur
Signatur
«Die Esche führt durch ihr Wesen der Duldsamkeit und Beugsamkeit dem geschilderten Menschentypen die erforderlichen Seelenkräfte zu.
Die Esche ist ein verbreiteter und häufiger Baum aus der Familie der Ölbaumgewächse (dazu gehören auch der Olivenbaum, Flieder, Jasmin, Forsythie und Liguster).
Das Holz der Esche ist ebenso hart wie das der Eiche, doch im Gegensatz zu diesem von höchster Elastizität. Es eignet sich daher besonders gut für Stiele von stark beanspruchten Werkzeugen und für Pfeilbogen. Früher wurden auch Flugzeugpropeller und Skier daraus gefertigt.
Jugendliche auf dem Land machen sich manchmal einen Spass daraus, auf junge Eschen zu klettern, um sich dann, an der Baumspitze hängend, langsam auf den Boden sinken zu lassen, was das ganze Bäumchen zu einem Riesenbogen spannt. Welch grausames Spiel mit einem Baum – doch kein anderer Baum als die Esche würde das ertragen.
Die Knospe ist der vitalste Teil einer Pflanze. Darin ist der ganze Trieb oder die ganze Blüte in Miniaturform enthalten und drängt zur Entfaltung. Eine Knospe birgt potenzielle Pflanzenenergie in höchstem Grad. Die Farbe, die diese Vitalität zum Ausdruck bringt, ist natürlich Grün, wie die der Blätter der meisten Pflanzen. Manchmal können Knospen auch rot sein und damit eine innewohnende Wärmekraft zum Ausdruck bringen. Würde es uns die Esche nicht zeigen, wären schwarze Knospen schwer vorstellbar. Die Esche hat also tatsächlich schwarze, samtartige Knospen und unterscheidet sich damit markant von anderen Pflanzen. Schwarz ist keine Farbe, sondern deren Abwesenheit, schwarze Flächen reflektieren kein Licht, Schwarz schluckt das lebensspendende Licht und ist darum in der belebten Natur sehr selten. Wir erkennen also einen enormen Gegensatz zwischen der Vitalität im Innern der Knospe und ihrer äusseren Farbe. Dieser Gegensatz erstaunt um so mehr, als die Esche zu den vitalsten und wuchskräftigsten Bäumen zählt.
Könnte das Eschenwesen durch diesen Gegensatz zum Ausdruck bringen, dass seine ganze Lebenskraft in den Dienst von anderen gestellt wird und nicht zur Vermehrung des eigenen Glanzes dient? Die Eschenblätter sind 9- bis 13-teilig gefiedert mit lanzettlichen, fein gezähnten Teilblättern. Die Anordnung der einzelnen Blätter folgt selbst in der mächtigsten Eschenkrone einem Plan, so dass immer noch direktes Sonnenlicht bis zum Boden dringen kann. Betrachtet man von unten her eine Baumkrone, ist die gleichmässige Beblätterung mit zahllosen Blätterspiralen deutlich zu erkennen. Blickt man – an einem sonnigen, nicht ganz windstillen Tag – wieder zu Boden, können wir uns an einem Spiel von tanzenden Lichtern im Schatten erfreuen. Das heisst, andere Lebewesen, die sich im Einflussbereich der mächtigen, schützenden Esche aufhalten, stehen nicht im Schatten, sie haben Zugang zum Licht, können sich ihrem Wesen gemäss entfalten.
Fallen die Blätter im Herbst, hinterlassen sie an den Zweigen auffallende Narben. Zweige von älteren Bäumen sind übersät mit solchen Blattnarben. Beim Verrottungsprozess der Eschenblätter gibt es ein bemerkenswertes, aber leider sehr seltenes und auch vielen Fachleuten unbekanntes Phänomen. Offensichtlich unter besonderen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen können verrottende Eschenblätter im Februar oder März einen wundervollen, blütenartigen Duft entwickeln. Ich habe einmal erlebt, wie ein ganzer Wald in dieser winterlichen Jahreszeit von Wohlgeruch erfüllt war. In der Auflösung der Lebenskräfte kann es geschehen, dass aus dem Eschenblatt etwas aufsteigt, was auf die Lebendigkeit des kommenden Sommers hindeutet.»
Wesen
«Der Menschentyp, den die Esche repräsentiert, ist mit einem zähen Durchhaltevermögen ausgerüstet. Hat er ein Ziel vor Augen, kann er eine fast grenzenlose Ausdauer und Geduld einsetzen, um dieses zu erreichen. Auch von Rückschlägen und Misserfolgen lässt er sich nicht beirren; misslingt ihm etwas, sieht er darin den Auftrag zu einer Optimierung, zu einem Neubeginn und nimmt seine Arbeit mit großem Elan sofort wieder auf. Dazu kann er sich abschotten und isolieren, bis das Ziel erreicht ist. Dies wird durch die schwarzen Knospen der Esche dargestellt. Mit ihrer dunklen Hülle schirmt sie das Innere vom Licht ab, um es zu bewahren, bis der Moment kommt, es ans Licht zu bringen.
Beim Bogenschießen verschmelzen Bogen, Pfeil (beides aus Eschenholz) und gespannte Sehne zu einer Einheit. Dieses Bild passt genau auf den beschriebenen Menschen, der alles zurücksetzt und sich anspannt zugunsten des anvisierten Ziels. Die Esche hat ein hohes Tragvermögen; sie stellt sich dabei aber nicht in den Mittelpunkt, sondern bleibt bescheiden. Sie ist der Prototyp des nicht auf schnellen Erfolg bedachten Wesens, dem das Ziel am wichtigsten ist.
Das Gegenteil dieses Verhaltens ist bei Menschen zu finden, die zu wenig Spannkraft, zu wenig Zielgerichtetheit aufbringen, um erfolgreich zu sein. Sie suchen die Schuld dafür bei äußeren Umständen oder bei anderen Menschen, grämen und ärgern sich darüber und lehnen sich dagegen auf. Es braucht nicht besonders betont zu werden, dass dieses Verhalten auf lange Sicht gesundheitliche Nachteile mit sich bringt. Ärger, Gram und der Kampf gegen vermeintliche Widerstände führen zu Fehlfunktionen im Körper. Chronische Entzündungsprozesse, rheumatische Beschwerden oder Polyarthritis können entstehen.
Die Esche führt durch die ihrem Wesen eigene Spannkraft, Tragfähigkeit und Beugsamkeit dem geschilderten Menschentyp die erforderlichen Seelenkräfte zu.»
Botanik
Fraxinus excelsior L., die Gewöhnliche Esche, ist ein bis 40 m hoch werdender sommergrüner Baum. Die, den Ölbaumgewächsen (Oleaceae) zugeordnete Esche, gehört damit zu den grössten einheimischen Laubbaumarten. Die wuchskräftige Art kann 200 bis 300 Jahre alt werden und findet sich gerne an feuchteren Standorten ein. Die Esche ist durch eine hohe Überflutungstoleranz gekennzeichnet und verträgt, je nach Pflanze, wenn sie bis zu 30 Tage oder mehr im überfluteten Uferbereich steht. Sie ist ein intensiver Tiefwurzler. Die Esche liefert ein wertvolles Holz, welches fast alle positiven Eigenschaften vereint, welche Holz besitzen kann: Elastizität, Biegsamkeit, Festigkeit, Splitterfreiheit und Dauerhaftigkeit. Die grünlich-graue Rinde der Esche ist anfangs glatt, später wird sie hellbeige und längsrissig. Die Esche zeigt meist einen gerade wachsenden Stamm, mit einer kugelförmigen, lockeren Krone. An ihren Zweigen zeigt sie die typischen und auffälligen schwarzbraunen Winterknospen. Aus diesen Knospen entfalten sich dann im Frühjahr zunächst die Blüten, was in warmen Jahren bereits im März passieren kann. Erst ab April bis in den Mai hinein entfalten sich dann die gegenständigen 20 bis 35 cm langen Blätter, welche unpaarig gefiedert sind. Sie weisen bis 15 Fiederblättchen auf, die meist 5 bis 11 cm lang und 1 bis 3 cm breit sind. Sie sind länglich oval bis lanzettlich, am Grunde keilförmig, lang zugespitzt und scharf gesägt. Eine ausgeprägte Herbstfärbung zeigt die Esche nicht. Die reifen Früchte der Esche werden mit dem Wind verbreitet. Um ihre Keimung auszulösen ist ein Kältereiz nötig. In einem Prozess der Nachreife wächst der Embryo dann über mehrere Monate im Boden zur vollen Grösse heran. Der junge, sich dann entwickelnde Keimling, wie auch die jungen Pflanzen, sind zunächst schattentolerant, ältere Eschen verlieren diese Toleranz aber und reagieren empfindlich auf Beschattung. Besonders in den letzten Jahren hat sich das sog. Eschensterben, ausgelöst durch einen Pilz, stark verbreitet und stellt heute für die Eschen in Mitteleuropa eine grosse Bedrohung dar.
Verwendung
Seit dem Altertum wird die Esche in der Literatur beschrieben und ist fest verankert in Mythologien und Sagen. So steht die Esche in der nordischen Mythologie als alles umfassender Weltbaum in hohem Ansehen. Durch das schnell nachwachsende harte Holz und einer Rinde, welche zum gerben und färben verwendet werden kann, gilt die Esche seit Jahrtausenden als sehr wertvolle Pflanze. Auch die medizinische Verwendung ist bereits seit Hippokrates bekannt. Medizinisch verwendet wurde der Saft, die Blätter, die Wurzeln, die Samen und die Rinde. Nebst der Anwendung als Antidot bei Schlangenbissen waren auch schon damals die bis heute in der Komplementärmedizin etablierte Anwendung der Esche als diuretisches und antirheumatisches Mittel bekannt.
Inhaltsstoffe
Hauptinhaltsstoffe der Esche sind phenolische Verbindungen: Flavonoide und phenolische Säuren wie Kämpferol und Quercetin, sowie Ferula- oder Kaffeesäure. Des weiteren sind unter anderem (Seco-)Iridoide, Triterpene, und Mineralstoffe enthalten.
Referenzen
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment report on Fraxinus excelsior L. or Fraxinus angustifolia Vahl, folium. EMA/HMPC/239269/2011 (2012).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- BGA/BfArM (Kommission D). Fraxinus excelsior. Bundesanzeiger 109 a, (1987).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2018).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.




FRAUENMANTEL
Alchemilla vulgaris aggr.
WESEN: Umhüllung, Behütung, Hervorbringung
Wesen und Signatur
Signatur
«Lassen Sie das Bild des Frauenmantels auf sich wirken! Bedarf es noch vieler Worte über die Signatur dieser Pflanze? Die gefässbildende Fältelung des Blattes spricht für sich und hat wohl immer wieder Anlass dazu gegeben, den Frauenmantel als überzeugendes Beispiel für die Signaturenlehre anzuführen. In dieser Hinsicht ist der Frauenmantel eine Ausnahme, denn die Signaturen der meisten Pflanzen erfordern eine sehr viel differenziertere Betrachtung. Auch die von den Wimpernhaaren des Blattrandes ausgeschiedene und sich im Blattgrund zum silbernen Tropfen vereinigende Flüssigkeit redet eine deutliche Sprache. Alchemilla verdankt ihren Namen der hohen Wertschätzung durch die früheren Alchemisten. Der Tautropfen aus ihrem Blattgrund wurde von ihnen gesammelt und als Ausgangssubstanz für die Herstellung von Elixieren verwendet. Sie ist gewissermassen die Alchemistin unter den Pflanzen. Einige weitere botanische Merkmale bringen ebenfalls das Wesen der Pflanze zum Ausdruck.
Die Frucht ist von einem weichen, glatten Kelchbecher umschlossen, mit diesem aber nicht verwachsen wie bei den anderen Gattungen und Arten aus der Familie der Rosaceae. Die Frucht entwickelt sich also geschützt, wie in einer Gebärmutter. Die meisten der zahlreichen Arten der Gattung Alchemilla sind apomiktisch, das heisst, sie entwickeln Früchte ohne Befruchtung. Sie entwickeln keinen normalen Pollen und die Staubbeutel platzen nicht, der Pollen wird nicht freigegeben.
Die Alchemillen sind sehr artenreich und unterscheiden sich oft nur durch schwer erkennbare Merkmale. Die exakte Bestimmung einer Pflanze ist meistens (selbst für erfahrene Botaniker) sehr aufwendig – oft sogar verwirrend – und generell nur möglich, wenn die Pflanze schon Früchte gebildet hat. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die Alchemilla-Arten nicht klar definiert sind und einer starken Variabilität unterworfen sind, das heisst ihre Merkmale über die Generationen hin immer wieder leicht verändern. Es ist aber gerade das Gegenteil der Fall. Dem Fachbuch «Flora der Schweiz» von Hess, Landolt, Hirzel entnehmen wir: «Von allen Spezialisten der Gattung Alchemilla wird die Konstanz der kleinen Artunterschiede über grosse geografische Gebiete als einzig dastehendes Beispiel bei den Blütenpflanzen geschildert.» Die Alchemilla-Arten sind also – obwohl von schwer durchschaubarer Vielfalt – ausserordentlich stabil in ihrer Gestalt, sie sind in sich selbst ruhend. Das lebensbewahrende Wesen kommt auch darin zum Ausdruck, dass die Pflanze stark antioxidativ wirkende Substanzen enthält.»
Wesen
«Welche andere Pflanze könnte die Wesensart des gebärenden weiblichen Schoßes, der Gebärmutter, besser verkörpern als der Frauenmantel? Im geborgenen Grund ihres mantelartig umhüllenden, nach oben empfangend geöffneten, weichen Blattes bringt die «Alchemistin» (Alchemilla!) unter den Pflanzen in rhythmischer Gebärde einen silbernen Tautropfen hervor. Alchemilla steht für die Bejahung der weiblichen Rhythmen und des Frauseins. Frauen, die ihre Identität zu sehr auf ihre Gebärfähigkeit abstützen, oder Frauen, die Schwierigkeiten haben, diesen Aspekt ihres Frauseins zu integrieren, verhilft der Frauenmantel zu einer gewissen Distanz. Der Frauenmantel wirkt kühlend, das bedeutet, dass er körperliche und seelische überschießende Wärmeprozesse ausgleicht. Auch seine gewebestärkende Wirkung ist bekannt. Auf der seelischen Ebene stärkt er den Mut zur echten Weiblichkeit: Eine zu starke oder zu schwache Betonung des Frauseins wird ausgeglichen.»
Botanik
Alchemilla vulgaris aggr. ist der Gemeine Frauenmantel. Die sehr ausdauernde Pflanze wird bis etwa 30 cm hoch. Im Frühjahr beginnt Alchemilla ihre grossen und charakteristischen, rundlich-nierenförmigen Blätter zu bilden. Diese sind zu Beginn der Entwicklung zunächst wie ein Fächer eingefaltet, später dann meist trichterförmig ausgebildet. Die Blattfläche selbst ist in einige dreieckig trapezförmige Lappen geteilt, der Blattrand ist gezähnt. Wie bei einer Perlenkette aufgereiht sind an den Blatträndern oft Wassertropfen zwischen den Zähnen zu finden. Dieses Wasser wird aktiv von der Pflanze ausgeschieden und kann sich wie eine grosse Perle am Grunde des Blattes sammeln, da dessen Oberfläche wasserabstossend ist. Die Pflanze blüht in den Monaten Mai bis September mit sehr vielen aber unscheinbaren Blüten. Die Blüten selbst sind nur 2 bis 4 mm lang und 3 bis 4 mm breit, sie sind gelbgrün gefärbt. So mag man kaum glauben, dass der Frauenmantel zu den Rosengewächsen gehört, die uns meist mit ihren nahezu perfekten Blütenkompositionen erfreuen. Eine weitere Besonderheit gibt es auch noch zu berichten: Im Moment der Entfaltung der Frauenmantel-Blüte ist diese bereits befruchtet und trägt den Embryo in sich, Alchemilla ist also nicht auf eine Fremdbestäubung angewiesen.
Verwendung
Alchemilla ist eine wichtige Heilpflanze in der ganzheitlichen Frauenheilkunde. Es verwundert deshalb nicht, dass der Frauenmantel schon zu Zeiten der Germanen sehr geschätzt wurde und der Frigga, der Göttin der Natur und ihrer Fruchtbarkeit, geweiht war. Mit der zunehmenden Christianisierung wurden die traditionellen Anwendungen und Bedeutungen der Alchemilla von der Frigga auf die Jungfrau Maria übertragen. Der Schweizer Kräuterpfarrer Johann Künzle schreibt in seinem Buch: «Das Frauenmänteli stärkt die Muskeln der Frauen in geradezu auffallender Weise…». In der Literatur findet sich ein sehr breites Spektrum von Anwendungen für die Alchemilla in der Frauenheilkunde. Unter Anderem gehören Fluor, Menorrhagie, Unterleibsentzündungen und -schmerzen, unregelmäßige Menses, Erschlaffungszustände des Unterleibs, sowie Vor- und Nachbereitung von Geburten zu den typischen Anwendungsgebieten. Aus Sicht der Phytotherapie liefert der hohe Gerbstoffgehalt einen Hinweis für eine adstringierende, entzündungshemmende und antioxidative Wirkung. Daher wird der Frauenmantel pflanzenheilkundlich gerne bei Durchfallerkrankungen angewendet. Auch gemäß dem homöopathischen Arzneimittelbild wird der Frauenmantel bei Durchfall und Weissfluss eingesetzt.
Inhaltsstoffe
Zu den charakteristischen Inhaltsstoffen des Frauenmantels gehören Gerbstoffe, vorwiegend Ellagitannine mit dem Hauptinhaltsstoff Agrimoniin, daneben Laevigatin F und Pedunculagin. Des Weiteren findet man Flavonoidglykoside.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- BGA/BfArM (Kommission E). Alchemillae herba ( Frauenmantelkraut ). Bundesanzeiger 173, (1986).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- BGA/BfArM (Kommission D). Alchemilla vulgaris. Bundesanzeiger 22a, (1988).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil




GÄNSEBLÜMCHEN
Bellis perennis L.
WESEN: Unberührtheit, Unschuld, Unversehrtheit, Kindlichkeit
Wesen und Signatur
Signatur
«Wer hat nicht als Kind Gänseblümchen gepflückt und daraus der Mutter ein Sträusschen gemacht? Klingt nicht ein ganz reiner, heller Ton in unseren Herzen an, wenn wir kleine Kinder dabei beobachten, wie sie Gänseblümchen pflücken und sich gegenseitig damit ihre Haare schmücken? Kinder fühlen eine innere Nähe zu dieser kleinen, bescheidenen Blume, die oft übersehen und getreten wird und sich dennoch ihre Unversehrtheit bewahrt. Das Gänseblümchen ist eine Rasen- und Wiesenblume. Es gehört zur artenreichen Familie der Korbblütler. Man kann den einfachen, klaren Aufbau des Blütenköpfchens wohl als Prototyp einer kindlichen Blume bezeichnen. Die Zungenblüten, beim Aufblühen rosa, werden später rein weiss, die Blütenscheibe ist ein einfacher, gelber Kreis. Wird der Rasen im Frühling zum ersten Mal gemäht und werden dabei die Blütenköpfchen abgehauen, geht es nicht lange, bis die Pflanze wieder neue Blüten bildet, nun aber mit kürzeren Stielen. Wird der Rasen noch kürzer gemäht, passt sich dieses Pflänzchen sofort wieder an. Es scheint unverwüstlich zu sein, es kennt nur eines: sein Blütenköpfchen nach oben zu recken und rein zu erhalten. Woher kommt diese Kraft, dieser Mut, dem man nichts anhaben kann? Die Pflanze hat eine ungewöhnlich widerstandsfähige Blattrosette, aus der sie immer wieder neue Kräfte mobilisiert.
Die zahlreichen Blätter sind alle bodenständig und bilden eine dichte Rosette. Beim genauen Betrachten der Blattstruktur nehmen wir scheinbar unvereinbare Eigenschaften wahr: derbe, fleischige Blätter, die dennoch einen starken Glanz ausstrahlen. Darin erkennen wir den Ausdruck von Robustheit und Vitalität. Beim Verblühen machen Pflanzen im Allgemeinen einen deutlich sichtbaren Wandel durch: Der Glanz der Farben und die Pracht der Formen weichen, die welken Blütenblätter mahnen an die Vergänglichkeit allen Lebens. Aber haben Sie schon einmal ein verblühtes Gänseblümchen gesehen? Natürlich machen sie keine Ausnahme – auch sie verblühen wie alles Leben. Doch ihnen ist es gegeben, derart diskret zu verblühen – die weissen Zungenblüten fallen ohne grosse Verfärbung rasch ab und das Gelb der Blütenscheibe nimmt das Grün des Rasens an –, dass sich die verblühten Pflänzchen wie unsichtbar in den Rasen einfügen. Das Gänseblümchen möchte also scheinbar nur Blüte sein und sich den Folgen des Fortpflanzungsprozesses (Welke und Reife) entziehen.»
Wesen
«Das Wesen des Gänseblümchens ist auf die Bewahrung der kindlichen Unschuld und Reinheit gerichtet. Es versucht sich vor Befleckung durch schuldhafte Verstrickungen, wie sie zum Älterwerden gehören, zu behüten. Da dies letztlich unmöglich ist, scheut es sich vor der Welt der Erwachsenen. So scheu und verletzlich es auch ist, kann es dennoch große Kräfte freisetzen, um die Folgen von Übergriffen auf seine seelische und körperliche Unversehrtheit zu heilen. Im anderen Namen dieser Pflanze, Maßliebchen, kommt zum Ausdruck, dass es in der Liebe Maß hält, das heißt, es dosiert die Leidenschaftlichkeit des Liebesverlangens, es dämpft die überschießende Potenz. Das Gänseblümchen ist eine wunderbare Hilfe bei allen seelischen und körperlichen Verletzungen, die durch ungestüme Gewaltanwendung, vor allem auch durch sexuelle Aggression entstanden sind.»
Botanik
Das Gänseblümchen (Bellis perennis L.), gehört zur Familie der Korbblütengewächse (Asteraceae). Es ist eine ausdauernde Pflanze, die 5 bis 15 cm hoch werden kann und mit ihrer vitalen grundständigen Blattrosette das gesamte Jahr sichtbar bleibt. Aus den leicht fleischigen, verkehrt-eiförmigen Laubblättern entspringen die blattlosen Blütenstängel an deren Spitzen die 10 bis 30 mm grossen Blüten stehen. Das Innere der Blüten ist aus gelben Röhrenblüten aufgebaut, am Rand stehen die weissen Zungenblüten, welche oft noch rosa überlaufen sein können. Die Pflanze erfreut uns fast das ganze Jahr mit ihren Blüten (Januar bis November), die Hauptblütezeit liegt aber eindeutig im Frühling. Werden die Blüten abgemäht oder abgefressen, so treiben aus der vitalen Rosette sofort wieder neue Blüten aus. Häufige Bewirtschaftung fördert die Pflanze sogar, weshalb sie sich gerne in kurzgeschnittenem Rasen vermehrt.
Verwendung
Das Gänseblümchen ist schon seit Jahrhunderten ein fester Bestandteil der Naturheilkunde und der Wildkräuterküche. Es handelt sich dabei um eine für Mensch und Tier ungiftige Heilpflanze. Bellis gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae), zu der auch viele weitere «Wundheilkräuter» wie Arnika und Calendula gehören. Es verwundert deshalb nicht, dass die phytotherapeutischen und homöopathischen Anwendungen von Bellis perennis L. viele Gemeinsamkeiten mit dem Wirkungsbild von Arnika aufweisen: Verletzungen, Schwellungen, Quetschungen, Verrenkungen, Verstauchungen und Blutergüsse. Als typische Empfindung gilt ein Wundheits- und Zerschlagenheitsgefühl im Bereich der Muskulatur. Die für Bellis charakteristischen Symptome sind zumeist die Folgen von Überanstrengung und Überarbeitung. Eine beliebte Form der Zubereitung für die innerliche Einnahme sind alkoholische Tinkturen und homöopathische Dilutionen bis D12. Die äußerliche Anwendung auf Muskeln und Gelenke ist ebenfalls sehr gebräuchlich. In der naturheilkundlichen Fachliteratur wird Bellis perennis L. auch zur Behandlung von Hautkrankheiten, vor allem bei Kindern, empfohlen. In der traditionellen Frauenheilkunde liegen gute Erfahrungen bei Gebärmutterblutungen und den Folgen von operativen Eingriffen vor.
Inhaltsstoffe
Zu den Hauptinhaltsstoffen von Bellis perennis L. gehören Triterpensaponine und Flavonoide (u. a. Glycoside des Apigenins, des Kaempferols und des Quercetins). Darüber hinaus konnten Gerbstoffe, ätherisches Öl, organische Säuren, schleimige und zuckerhaltige Verbindungen ebenfalls nachgewiesen werden.
Referenzen
- Hänsel, R., Keller, K., Rimpler, H. & Schneider, G. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis Band 4 Drogen A-D. (Springer-Verlag, 1992).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- BGA/BfArM (Kommission D). Bellis perennis. Bundesanzeiger 190 a, (1985).
- Vonarburg, B. Homöothanik – Arzneipflanzen der Homöopathie. (Haug Verlag, 2009).
- Committee for veterinary medicinal products. Bellis perennis Summary Report. EMEA/MRL/663/99-FINAL (1999).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil




GELBER ENZIAN
Gentiana lutea L.
WESEN: Überwindung, Verdauung, Zerteilung
Wesen und Signatur
Signatur
«Wenn wir den Namen Enzian hören, denken wir in der Regel an schöne, tiefblaue Blumen, die wie kleine Glocken unsere Alpweiden zieren. Der blaue Enzian ist wohl der Inbegriff der Bergblume. Die Heilpflanze Enzian ist jedoch von ganz anderer Art. Wie schon ihr Name sagt, sind ihre Blüten gelb, und ausserdem ist sie mit einer Grösse von bis zu 1,2 m eine sehr stattliche Pflanze.
Der gelbe Enzian hat bis zu 30 cm lange und 15 cm breite ovale Blätter mit stark hervortretenden Nerven. Die Blätter gleichen jenen des sehr giftigen weissen Germers (Veratrum album), was zu gefährlichen Verwechslungen führen kann. Durch die gegenständige Blattstellung kann der Enzian jedoch leicht vom Germer unterschieden werden, dessen Blätter wechselständig sind. Die oberen Blätter des gelben Enzians sind wie Halbschalen gewölbt. Zu Beginn umschliessen diese Schalen den Stengel und verbergen in ihrem Innern die Blütenknospen. Wenn sich die Blattschalen öffnen und in die Horizontale legen, geben sie eine grosse Anzahl von Blüten frei. Diese haben eine für die Gattung Enzian völlig untypische Gestalt. Die Kronblätter der anderen Enzianarten sind vom Grund bis weit über die Mitte miteinander verwachsen und bilden dadurch glocken- oder röhrenförmige Blüten. Die Blüten des gelben Enzians hingegen sind fast bis zum Grund geteilt. Ausserdem sind die Kronblätter schmal und lang, so dass sie im voll aufgeblühten Zustand anders als bei der typischen Enzianblüte als einzelne, abgetrennte Elemente in den Vordergrund treten und wie fünf- bis sechsstrahlige Sterne aussehen. Da der Blütenstand des gelben Enzians ausserdem aus zahlreichen Einzelblüten zusammengesetzt ist, die in verschiedene Richtungen blicken, wirkt er sehr inhomogen, um nicht zu sagen wirr. Wir erkennen deutlich, dass hier ein stark zerteilendes Wesen an der Gestaltung mitgewirkt hat. Die den Stengel umfassenden Blätter mit den Blütenknospen in ihrem Innern können wir als feste Einheit auffassen, in deren Innern – in den Blüten – ein zerteilendes Prinzip wirksam wird. Die teilende Kraft ist auch an den mächtigen Wurzeln erkennbar. Sie können als vielköpfig bezeichnet werden, wobei die einzelnen Teile sich immer wieder ineinander verschlingen.
Die innere Betrachtung des Wesens dieser Pflanze lässt eine Verwandtschaft mit dem Wesen des Rinds erkennen. Das Rind ist das Tier, dessen Wesen wohl am stärksten auf die Verdauung ausgerichtet ist. Die Kuh ist tiergewordenes Verdauungsprinzip. Die Gestalt des Rinds ist relativ blockförmig, und im Innern dieses Blocks wirkt die zerteilende Kraft der Verdauung.
Der Enzian kann geradezu als ein Wundermittel zur Zerteilung von schwer verdaulichen Kuhmilchprodukten bezeichnet werden, von warmen Zubereitungen aus Käse wie zum Beispiel Pizza, Raclette oder Fondue. Enzian ist wohl die am stärksten wirkende Heilpflanze zur Unterstützung der Verdauung.»
Wesen
«Der Verdauungsprozess und die Verarbeitung von Gefühlseindrücken haben viele Gemeinsamkeiten. Bei beiden müssen die aufgenommenen wesensfremden Substanzen und Energien überwunden und verarbeitet, einverleibt werden. Können bewegende Ereignisse oder Bilder emotional nur schwer verdaut werden, so besteht meist auch eine organische Verdauungsschwäche. Oft liegen dann Gefühle oder eben Nahrungsmittel schwer auf dem Magen, und es entsteht ein starker Druck in der Magengegend.
Enzian besitzt die Wesenskraft, Fremdes zu überwinden und zu zerteilen, und unterstützt dadurch sowohl die körperliche als auch die seelische Verdauung. Enzian hilft insbesondere bei der Eiweißverdauung.»
Botanik
Der Gelbe Enzian, Gentiana lutea L., ist eine bis über 140 cm hoch werdende Staude aus der Familie der Enziangewächse (Gentianaceae). Der gelbe Enzian ist eine imposante Pflanzengestalt, die an ihrem natürlichen Standort, den Gebirgen Mitteleuropas bis nach Osteuropa hinein, bis 60 Jahre alt werden können soll. Aus ihrem grossen und oft mehrköpfigen, wulstig quergerillten Wurzelstock treibt die Pflanze eine bis 1 m lang werdende glatte Wurzel in den Boden. Die Mächtigkeit der unterirdischen Teile des Enzians zeigt sich, wenn man weiss, dass das Frischgewicht von Wurzelstock und Wurzel bei nur einer Pflanze bis zu 7 kg betragen kann. Oberirdisch entwickelt sich zunächst nur eine grundständige Rosette elliptischer Blätter. Ab dem vierten Jahr, teilweise erst später, treibt dann ein daumenstarker, aufrechter und hohler Stängel aus der Rosette aus. Die sich daran bildenden, sitzenden, blaugrünen Blätter des Enzians sind kreuzgegenständig angeordnet und haben eine breit elliptische, löffelartig nach innen gewölbte Form. Sie sind, mit 5 bis 7 Nerven je Blatt, parallelnervig. In den schalenförmigen Blattachseln bilden sich ab etwa Juni bis in den August hinein die gelben Blüten der Pflanze. Es sind wunderschöne, gelbe Sterne, die in 3 bis 7 Etagen in Scheinquirlen an der Pflanze stehen. Bis zu 100 Blüten sind an einem Spross gezählt worden. Die 5 bis 6 manchmal bis zu 9 Kronblätter der Blütensterne sind nur am Grund zu einer Röhre verwachsen, ansonsten sind sie frei. Auffallend sind die gelben bis orangeroten Staubgefässe, die sich in den Blüten zeigen. Manchmal kommt es, im nicht blühenden Zustand zu Verwechselungen des Enzians mit dem Weissen Germer (Veratrum album), der sehr giftig ist. Die Blätter des Germers stehen aber, im Gegensatz zu den Blättern des Gelben Enzians, wechselständig und nicht kreuzgegenständig an der Pflanze.
Verwendung
Seit Jahrhunderten gilt die Wurzel des gelben Enzians, Gentiana lutea L., als bitteres Magen- und Gallemittel, sowie allgemeines Tonikum. Zwischen den Anwendungsempfehlungen traditioneller Kräuterbuchautoren und neuesten wissenschaftlichen Untersuchungen besteht beim Enzian eine auffällig große Übereinstimmung. Der bittere Enzian regt die Speichel-, Magen- und Gallensekretion an. Zu den Anwendungsgebieten gehören somit Verdauungsbeschwerden wie Appetitlosigkeit, Völlegefühl und Blähungen. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass die Anwendungsmöglichkeiten von bitterstoffhaltigen Heilpflanzen auch über die Verdauungsbeschwerden hinausgehen. Über die Anregung des Appetits kann der Enzian als Bittermittel stärkend nach längeren Erkrankungen oder bei Magersucht angewendet werden. Über die Wahrnehmung von Bitterstoffen über das Verdauungssystem wird zudem auch das zentrale Nervensystem und der gesamte Organismus involviert. So können auch Anwendungen bei depressiver Verstimmung und zur allgemeinen Stärkung begründet sein.
Inhaltsstoffe
Die Wurzeln des gelben Enzians, Gentiana lutea L., enthalten reichliche Mengen an Bitterstoffen, die dieser Heilpflanze ihren charakteristischen Geruch und Geschmack verleihen – der Bitterwert ist vergleichbar mit demjenigen des Wermuts. Zu diesen Bitterstoffen gehören Secoiridoidglykoside wie Gentiopicrosid und Amarogentin. Weitere Bestandteile dieser Wurzeldroge sind Mineralien und Zuckerverbindungen, darunter die bitter schmeckende Gentiobiose.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- BGA/BfArM (Kommission E). Gentianae radix (Enzianwurzel). Bundesanzeiger 223, (1985).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment Report on Gentiana Lutea L., Radix. EMA/HMPC/607863/2017 (2018).
- BGA/BfArM (Kommission D). Gentiana lutea. Bundesanzeiger 217 a, (1985).
- Saller, R., Melzer, J., Uehleke, B. & Rostock, M. Phytotherapeutische Bittermittel. Schweizerische Zeitschrift fur GanzheitsMedizin 21, 200–205 (2009).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2018).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil




GINKGO
Ginkgo biloba L.
WESEN: Einheit von Bild und Spiegelbild, Gleichgewicht der Polaritäten
Wesen und Signatur
Signatur
«Das zweilappige Ginkgoblatt übte schon immer eine grosse Faszination auf den Menschen aus. Es dient als Motiv für Schmuck und Ornamente, wird in der bildenden Kunst dargestellt, verziert wertvolle Gebrauchsgegenstände und erscheint in Firmenlogos. In der Goethe-Stadt Weimar begegnet uns auf Souvenirs das berühmte Gedicht des grossen Dichters über das Ginkgoblatt auf Schritt und Tritt.
Dem Ginkgoblatt haftet die Aura des Aussergewöhnlichen an, denn es gibt kein anderes Blatt, das ihm nur annähernd vergleichbar wäre. Der Ginkgobaum scheint in der Evolution am Übergang zwischen Nadelbäumen und den höher entwickelten Laubbäumen zu stehen. Die Botaniker sprechen von einem lebenden Fossil, weil der Ginkgo aus einer sehr alten Pflanzenfamilie stammt, die bis auf diese eine Art ausgestorben ist. Der Ginkgo ist wohl eines der tiefgründigsten Symbole aus der Natur für das Mysterium des Menschseins. Der Mensch, ein gespaltenes Doppelwesen; der Einheit entsprungen, zur Einheit gerufen. Die Trennung in zwei polare Hälften ist ein umfassendes Merkmal von Mensch und Natur, nicht nur der Geschlechter. Alles steht unter dem gleichen Gesetz der Polaritäten, der Gegensätze, die sowohl Leben als auch Konflikt und Tod hervorbringen. Die Spaltung in die Polaritäten und ihre Konflikte hat einen Anfang. Die Bibel spricht vom Essen der Früchte des Baums der Erkenntnis von Gut und Böse. Dies ist die symbolische Andeutung dafür, dass die Trennung, der Verlust der Einheit der beiden Lebenspole, im Bewusstsein und Denken begründet liegt. Spiegelbildlich dazu gründet der Weg zurück zur Einheit in einem anderen, neuen Bewusstsein, genährt aus den Früchten des Baums des Lebens.
Warum zeigt uns gerade das zweilappige Ginkgoblatt (lateinisch biloba = zweilappig) das Wesen von Teilung und Einheit, wo es doch auch viele andere Pflanzen gibt, die in irgendeiner Weise die Zahl zwei zum Ausdruck bringen? Die Antwort finden wir in der Blattnervenstruktur des Ginkgos. Um jedoch deren Besonderheit zu begreifen, müssen wir uns zuerst die Struktur der Nervatur, wie sie üblicherweise auftritt, vor Augen führen. Die entwicklungsgeschichtlich einfacheren Pflanzenarten (einkeimblättrige) haben Blätter mit parallel laufenden Nerven. Die höher entwickelten (zweikeimblättrige) haben meistens Blätter mit einer netzartig verzweigten Nervenstruktur; wir erkennen einen Hauptnerv in der Mitte des Blattes, daraus verzweigen sich Nebennerven, und von diesen trennen sich wiederum kleinere Nerven ab. Im Überblick betrachtet zeigt sich oft ein ähnliches Bild wie das eines grossen Stroms mit Nebenflüssen und Nebenbächen. Manchmal haben Blattnerven auch eine Netzstruktur. Beim Ginkgoblatt finden wir nun die Ausnahme eines streng zweiteilig gegabelten Verzweigungsmusters. Folgen wir einem Nerv vom Blattgrund nach aussen, so finden wir an der Verzweigungsstelle kein seitliches Abzweigen eines kleineren Nervs, sondern der Ursprungsnerv teilt sich in zwei genau gleich starke Folgenerven und so weiter. Das ergibt für die Verzweigung der Nerven dasselbe Muster, wie wenn wir Ja-Nein-Entscheidungsprozesse in Form eines Baumdiagramms grafisch darstellen. Gehen wir also vom Ursprung des Ginkgoblatts zur Peripherie, so folgen wir einem Weg der wiederholten Spaltung in Zwei (= Analyse), gehen wir den umgekehrten Weg, von der Peripherie zum Ursprung, so folgen wir einem Weg der wiederholten Vereinigung von Zwei (= Synthese).
Angesichts dieser tiefgründigen Struktur der Nervatur könnte es beinahe schon banal wirken, auf die frappante Ähnlichkeit der Peripherie des zweilappigen Ginkgoblattes mit einem Querschnitt durch die beiden Hirnhälften hinzuweisen.»
Wesen
«Alles in der Natur entsteht, wird bewegt und vergeht durch Kräfte, die aus dem Spannungsfeld zweier Pole hervorgehen. Dieses Polaritätsgesetz ist fundamental gültig und offensichtlich; wir finden es in den Gegensätzen von Tag und Nacht, Mann und Frau, Jugend und Alter usw. Trotzdem vergessen wir immer wieder, dieses Polaritätsgesetz in die Praxis unseres täglichen Lebens miteinzubeziehen. Meist wird die eine Seite einer Sache bevorzugt und festgehalten, die dazugehörige andere Seite aber abgelehnt oder bekämpft. Dadurch geht Dynamik und Lebenskraft verloren, denn diese kann ausschließlich im Spannungsfeld von Gegensätzen bestehen, die einander gleichberechtigt gegenüberstehen oder die sich in zeitlicher Folge ablösen.
In unserer Kultur wird das kausal-analytische Denken der linken Gehirnhälfte überbewertet und gefördert, wodurch das analog-synthetische Denken der rechten Hirnhemisphäre vernachlässigt wird und verkümmert. Dabei kann auf die Dauer ein Vitalitätsverlust des Gehirns und eine Degeneration seiner Funktionen als Ganzes nicht ausbleiben.
Ginkgo symbolisiert mit seinem zweilappigen Blatt, das in sich selbst die beiden Pole – Männlich und Weiblich – vereinigt, die Einheit und das Gleichgewicht der Polaritäten. Da im Gleichgewicht die Lebenskraft am stärksten ist, hat der Ginkgobaum eine sehr hohe Vitalität, was seine enorme, im Pflanzenreich unübertroffene Widerstands- und Regenerationskraft beweist. Diese Vitalität regeneriert die Leistungsfähigkeit des Gehirns, jenes Organs, das als einziges in unserem Körper beide Pole in sich birgt.»
Botanik
Ginkgo biloba L., ist ein langsam wachsender 10 bis 30 m hoch werdender sommergrüner Baum, der bis deutlich über 1000 Jahre alt werden kann. Aktuelle Forschungen lassen vermuten, dass der Ginkgo biloba L. besondere Fähigkeiten hat, mit Alterungsprozessen umzugehen. Ginkgo biloba L. ist der einzige Überlebende einer Gattung, die sich seit mehr als 150 Millionen Jahren nur wenig verändert hat und er ist der einzige heutige Vertreter der Familie der Ginkgoaceae. Bereits seit etwa 65 Millionen Jahren ist eine Art nachweisbar, deren fossile Blätter nicht von denen eines heutigen Ginkgo zu unterscheiden sind, deswegen wird der Ginkgo biloba L. auch oft als lebendes Fossil bezeichnet. Ursprünglich war er in Mitteleuropa heimisch, ist aber durch die Eiszeiten schliesslich ausgestorben. Überlebt hat er in einigen Arealen von Asien, von wo aus der Mensch ihn dann wieder auf der Welt verbreitet hat. Heute ist er, gerade wegen seiner Resistenz gegen Krankheiten und Umweltverschmutzungen ein beliebter Parkbaum.
Charakteristisch für den Ginkgo biloba L. sind seine lederartigen Fächerblätter die oft gebüschelt an seinen Trieben stehen. Die Blattspreite weist keinen Mittelnerv auf und zeigt eine besondere Blattaderung: Seine Blattadern verlaufen parallel und verzweigen sich gabelig. Nach der Gabelung laufen sie parallel weiter ohne an Stärke abzunehmen. Normalerweise weisen die Blätter von Pflanzen, entweder eine reine Parallelnervatur ohne Gabelung oder eine netzartige Nervatur auf, bei denen die Nerven dann immer kleiner werden. Seine Blattspreite ist oft einmal oder auch mehrfach tief eingeschnitten, was zu dem Beinahmen «biloba» zweilappig führte. Seine intensiven grünen Blätter färben sich im Herbst leuchtend gelb und erfreuen uns dann mit ihrer Strahlkraft bevor der Ginkgo biloba L. sie dann abwirft. Ginkgo biloba L. ist eingeschlechtig, d.h. es gibt rein männliche und rein weibliche Bäume. Die Blüten erscheinen im Mai und sind sehr unscheinbar, um zu Blühen muss der Baum aber ein Alter von 20 bis 30 Jahren erreichet haben. Im Herbst entwickeln sich an den weiblichen Bäumen die mirabellengrossen Samen die im Reifezustand einen unangenehmen Geruch entwickeln. Daher sind in Mitteleuropa meist nur männliche Bäume anzutreffen.
Verwendung
Der ursprünglich aus Asien stammende Ginkgo biloba L. gilt als besonders gut untersuchte Heilpflanze, der eine durchblutungsfördernde Eigenschaft zugewiesen wird (Förderung der Mikrozirkulation). Durch die Verbesserte Durchblutung des Gehirns soll er die Hirnleistung bei Gedächtnisschwäche fördern, aber auch bei Tinnitus und Schwindel (Durchblutung des Innenohrs) helfen. Zur Erklärung der durchblutungssteigernden Wirkungen kann eine Entspannung der Blutgefäße und auch eine Verbesserung der Fließfähigkeit des Blutes herangezogen werden. Weitere Forschungen befassen sich mit der Frage, inwieweit die Wirkungsweise von Präparaten aus Ginkgoblättern auf antioxidative Effekte gegen freie Radikale zurückzuführen ist. Die Pflanzenheilkunde konzentriert sich bei der Verwendung von Ginkgo biloba L. auf die Herstellung standardisierter Spezialextrakte die primär bei Störungen des zentralen Nervensystems und leichten dementiellen Erkrankungen angewendet werden. Auch beim Ginkgo biloba L. kann man erkennen, dass sich Heilpflanzen in den meisten Fällen nicht eindeutig einer Therapierichtung zuordnen lassen, sondern ganzheitlich zu betrachten sind. Zum Beispiel findet man das Anwendungsgebiet «Kopfschmerz» sowohl in der Pflanzenheilkunde, als auch in der Homöopathie wieder.
Inhaltsstoffe
Typische Inhaltsstoffe von Ginkgo biloba L. sind Flavonole, Flavone, Biflavone (Ginkgetine), Proanthocyanidine, Sesquiterpene (Bilobalide), Diterpene (Ginkgolide), Ginkgole und organische Säuren (darunter Ginkgolsäuren).
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- Hänsel, R., Keller, K., Rimpler, H. & Schneider, G. Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis Band 5 Drogen E-O. (Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1993, 1993).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment report on Ginkgo biloba L ., folium. EMA/HMPC/321095/2012 (2014).
- BGA/BfArM (Kommission D). Ginkgo biloba. Bundesanzeiger 217 a, (1985).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil




GOLDRUTE
Solidago virgaurea L.
WESEN: Verbindung, Liebe, Trost, Beziehungsfähigkeit, Fluss der Gefühle
Wesen und Signatur
Signatur
«In Mitteleuropa findet man drei Arten der Gattung Solidago: die einheimische Solidago virgaurea L., die Echte oder Gemeine Goldrute, welche die Stammpflanze für die Urtinktur liefert, und die beiden grosswüchsigen, aus Nordamerika eingeschleppten und verwilderten Arten S. canadensis und S. gigantea. Das Augenfälligste an der Echten Goldrute ist das strahlende goldgelbe Blütenkleid. Zahlreiche Blütenkörbchen bilden dichte, endständige Rispen. Die Gesamtheit der Blüten vermittelt einen harmonischen, vollendeten Eindruck. Betrachtet man jedoch ein einzelnes Blütenkörbchen aus der Nähe, so entdeckt man eine bei den Korbblütlern sehr seltene Unvollkommenheit: Die randständigen Strahlenblüten bilden nicht wie üblich (wie z. B. bei der Sonnenblume) einen vollständigen Kranz, einen lückenlose Blütenkrone. Es bestehen zahlreiche Lücken, so dass die einzelnen Blütenköpfchen unvollständig sind. Durch das dichte Zusammenstehen der Blütenstände jedoch reichen die Strahlenblüten der einen Körbchen in die Lücken der anderen und ergänzen sich auf diese Weise gegenseitig. Gerade die Unvollständigkeit der einzelnen Blüten führt durch die Verbindung und gegenseitige Ergänzung zu einem harmonisch vernetzten Ganzen. Die Echte Goldrute wächst in trockenen, lichten Wäldern, an Waldrändern und Böschungen. Sie tritt nur vereinzelt oder in lockeren Beständen auf und unterscheidet sich dadurch von den nordamerikanischen Arten, die sich sehr stark ausbreiten und mit ihren dichten Beständen die einheimische Flora verdrängen. Im Spätsommer und Herbst leuchten deren gelbe Blütenstände weithin sichtbar und schmücken ihre Standorte – Gärten, Bahndämme, Flussufer und Ödplätze. Die Echte Goldrute hingegen ist ausserordentlich wählerisch in Bezug auf die Harmonie ihrer Standorte. Diese haben meistens einen besonderen Reiz und laden durch ihre Schönheit und Atmosphäre zum Verweilen und Auftanken ein.
Während die eingeschleppten Goldrutenarten durch die sich ausbreitenden, dichten Bestände eine grosse Lebenskraft beweisen, bringt die Echte Goldrute ihre ebenbürtige Vitalität auf eine andere Art zum Ausdruck; sie besitzt eine ungewöhnliche Ausstrahlung mit einer starken emotionalen Anziehungskraft. Zusammen mit Arnika und Johanniskraut gehört die Echte Goldrute wohl zu den Heilpflanzen mit der stärksten Ausstrahlung. Der einfühlsamen Betrachtung entgeht nicht, wie sich die Pflanze bald nach der Ernte auffällig verändert. Noch bevor der natürliche Welkprozess einsetzt, werden die Blüten und Blätter matt und verlieren ihren schönen Glanz. Man spürt, wie die Goldrute unter der Trockenheit leidet und nach Wasser verlangt. Für eine Pflanze, die an trockenen Standorten wächst und naturgemäss mit wenig Wasser auskommt, ist das Ausmass dieser Reaktion ungewöhnlich. Jede Pflanze braucht Wasser; über dieses biologische Erfordernis hinaus besitzt die Goldrute jedoch ein wesenhaftes Bedürfnis nach der Verbindung mit dem Wasser. Die Pflanze behält ihre Ausstrahlung und Schönheit nur in der ständigen Anbindung an das fliessende Element. Abgeschnitten und auf sich allein gestellt, wird sie fad und ausdruckslos, ihrem Wesen entfremdet. Der Geruch und Geschmack ist angenehm erfrischend, leicht und unaufdringlich aromatisch und erinnert an Honig, eine Andeutung des verbindenden, freundlichen Wesens der Pflanze. Die Signatur der Echten Goldrute bringt ihr auf Verbindung, Ergänzung, Harmonie, Lebenskraft und Fluss ausgerichtetes Wesen deutlich zum Ausdruck. Es besitzt alle Merkmale einer harmonischen Beziehung in gegenseitiger emotionaler Ergänzung. Die Goldrute verkörpert auf der psychischen Ebene den Bereich von Partnerschaft, Liebe und Beziehungsfähigkeit. Diesem Bereich entspricht auf der physischen Ebene die Nierenfunktion. Ebenso wie die Goldrute ein spezifisches Nierentherapeutikum darstellt, repräsentiert ihr Wesen die spezifischen Kräfte, die für eine harmonische emotionale Beziehung, für eine echte Freundschaft erforderlich sind.Vielfach sind Nierenfunktionsstörungen der physische Ausdruck einer gestörten Beziehungsfähigkeit, einer Störung in der Wechselwirkung zwischen emotionalem Geben und Nehmen. In solchen Fällen können die Wesenskräfte der Goldrute einerseits zu einer Wahrnehmung und Bewusstwerdung der eigenen Problematik führen, während andererseits die Nierenfunktion angeregt wird.
Die Goldrute verbindet, was getrennt wurde. Sie heilt Wunden auf der physischen wie auch im Sinne einer emotionalen Unterstützung auf der psychischen Ebene. Die Pflanze war in früheren Jahrhunderten eines der bewährtesten Wundheilkräuter und trug ursprünglich den Namen «heidnisch Wundkraut». Im lateinischen Solidago (von solidum agere = das in der Verwundung Getrennte wieder fest zusammenfügen) kommt auch das verbindende Wesen zum Ausdruck.»
Wesen
«Durch sein Wesen, das eine innig freundschaftliche Beziehung symbolisiert, verbindet Solidago das Getrennte und Unvollständige zu einem Ganzen. Freundschaft und Liebe verbindet die Menschen und aktiviert die Energien, die eine gesunde Nierenfunktion ermöglichen. Wenn der harmonische Fluss der verbindenden Gefühle versiegt, wenn Enttäuschungen, Frustrationen und Schuldgefühle Beziehungen blockieren, wird die psychische Energie geschwächt und die Nieren leiden. Die Goldrute ist das spezifischste Nierenfunktionsmittel. Sie ist insbesondere bei Nierenleiden angezeigt, die mit schmerzlichen Erfahrungen in Beziehungen und Partnerschaften und bei Beziehungsverlusten zusammenhängen.»
Botanik
Die Gewöhnliche Goldrute (Solidago virgaurea L.) ist eine Pflanze aus der Familie der Korbblütler (Asteraceae). Bei ihr handelt es sich um eine ausdauernde Staude, welche im ersten Jahr meist nur eine Rosette aus länglichen bis eiförmigen Blättern zeigt. Ab dem zweiten Jahr bildet die Pflanze dann ihre runden, wechselständig beblätterten Stängel aus, welche sehr fest sind und bis etwa 100 cm in die Höhe wachsen. Sie verzweigen sich mehr oder weniger stark. Oft werden die unteren Seitenäste länger als die oberen, so dass ihre Spitzen, mit den Blüten nachher fast auf einer Ebene liegen. Die Gewöhnliche Goldrute blüht ab etwa Juli bis in den Herbst hinein mit strahlend goldgelben Blüten, die zu harmonisch aussehenden Rispen zusammengefasst sind.
Verwendung
Die Goldrute, Solidago virgaurea L., ist eines der wichtigsten organspezifischen Nierenmittel in der Phytotherapie. Mit ihrer diuretischen, spasmolytischen, antiphlogistischen, sowie antimikrobiellen Wirkung dient sie als zentrales Basismittel bei der Behandlung vieler Erkrankungen des Urogenitaltraktes. Arzneiliche Zubereitungen aus Goldrute reichen von der klassischen Teetherapie, über Phytopharmaka-Extrakte hin zu alkoholischen Tinkturen. Über die Wirksamkeit liegen zahlreiche Anwendungsbeobachtungen und Studien vor. Die Pflanzenheilkunde nennt für arzneiliche Zubereitungen aus Solidago virgaurea L. folgende Indikationsstellung: Zur Erhöhung der Harnmenge und somit Durchspülung bei Entzündungen im Bereich der Niere oder Blase. Entzündliche und bakterielle Erkrankungen der ableitenden Harnwege und die vorbeugende Behandlung bei Harnsteinen und Nierengriess sind typische Anwendungsgebiete der Goldrute. Die Wirkweise wird als diuretisch, schwach spasmolytisch und antiphlogistisch beschrieben. Die Homöopathie nennt als Anwendung ebenfalls Nierenschwäche. Die Goldrute kann auch als Begleitmedikation bei der Harnsauren Diathese dienen. Diese manifestiert sich vielfach, begünstigt durch fehlerhafte Ernährungsgewohnheiten, in Form von rheumatischen und gichtartigen Beschwerdebildern. Der rheumatische Formenkreis, sowie die Anwendung als Blutreinigungsmittel bei chronischen Ekzemen gehören in der Volksheilkunde ebenfalls zu den Anwendungsgebieten der Goldrute.
Inhaltsstoffe
Die Goldrute, Solidago virgaurea L., enthält Flavonoide und andere phenolische Verbindungen. Dazu gehören beispielsweise Quercetin, Kämpferol und Rutin resp. Virgaureoside. Neben Triterpensaponinen findet sich in der Goldrute auch ätherisches Öl, das überwiegend aus Mono- und Sesquiterpenen besteht. Des Weiteren sind Diterpene enthalten.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissensch. Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- BGA/BfArM (Kommission E). Solidago (Goldrute). Bundesanzeiger 193, (1987)
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- BGA/BfArM (Kommission D). Solidago virgaurea. Bundesanzeiger 29a, (1986)
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Community herbal monograph on Solidago Virgaurea. EMA/HMPC/285758/2007 (2008).
- Hänsel, R., Keller, K., Rimpler, H. & Schneider, G. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis Band 5 Drogen P-Z. (Springer Verlag Berlin Heidelberg, 1994).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil




GUNDELREBE
Glechoma hederacea L.
WESEN: Loslassen und Erneuerung, Gelassenheit, lebenserweckende Wärme
Wesen und Signatur
Signatur
«Die Gundelrebe ist so lebendig und kommunikativ, dass sich ihr Wesen dem einfühlsamen Betrachter schon nach kurzer Zeit offenbart. Schwieriger ist es, die innere Wahrnehmung an der Signatur zu verifizieren. Mit wenigen Pflanzen habe ich so viele Stunden intensiven Studiums verbracht, ohne ihre Schlüsselmerkmale zu entdecken. Ich machte den Fehler, mich vor allem der Einzelpflanze zu widmen, studierte deren Formen und Farben bis ins Detail und konnte dadurch ihrem Wesen nicht gerecht werden. Die Gundelrebe ist keine Einzelgängerin. Sie kommt erst dann ihrem Wesen gemäss zur Geltung, wenn sie Teil eines grösseren Ganzen, eines Bestandes von gleichen Pflanzen ist. Die Gundelrebe strebt nicht nach Selbstdarstellung. Sie hebt sich nie vor dem Hintergrund ab, sondern sucht gemeinsam mit anderen die Ausbreitung in die Horizontale. Ihr Wesen ist es mitzuschwingen mit den Rhythmen und Kräften der Natur. Die Gundelrebe kann mit den Lebenskräften in Resonanz treten und wirkt dadurch als ihr Verstärker. Um einen Gundelrebenstandort spüren wir höchste Lebendigkeit und die Gegenwärtigkeit von Elementarwesen, den so genannten Erdgeistern, die für das Pflanzenwachstum sorgen.
Betrachten wir den Bestand und schauen etwas unscharf, so nehmen wir ihn als Ganzheit und nicht nur seine Teile wahr. Wir sehen jetzt eine reiche Zahl von Rundformen, die miteinander zu kommunizieren scheinen. Das Bild wird zusammengehalten durch die rundlichen Blätter mit ihren rund gekerbten Blatträndern. Die vielen Halbkreise sind wie Elemente von Wellenlinien, von Schwingungsmustern, die durch den ganzen Bestand vibrieren und ihn zu einer Einheit verbinden. Darin zeigt sich die Fähigkeit, in Resonanz zu treten mit den umgebenden Lebenskräften. Welcher Art sind die Kräfte, mit denen die Pflanze in Resonanz tritt? Es sind die Sonnenkräfte, die auf die Verlebendigung der Erde gerichtet sind. So sind denn auch die jungen Blätter am Vegetationspunkt jeweils zu zweien flach aneinander geschmiegt, wie zwei zusammengefaltete, nach oben gerichtete Hände. Die Pflanze ist ausgeprägt warm und erdverbunden. Ihr Aroma ist würzig warm und von stark erdigem Charakter, ihre Blätter sind im Jugendstadium violett-braun überzogen und gleichen sich in ihrer Farbe oft dem rotbraunen Erdboden an.
Die Gundelrebe gehört zur Familie der Lippenblütler, eine Familie, die viele Gewürz- und Heilpflanzen hervorbringt, die in ihren typischen Aromen vor allem das Element der Sonnenwärme in Substanzform assimiliert haben. Die Gundelrebe ist die erste Art dieser Familie, die im frühen Frühling mit ihrem warmen, erdigen Aroma die Winterstarre überwindet. Die Blüten sind ausladend, sie dehnen sich sehr weit in die Horizontale, oft über die Blätter hinaus, die Oberlippe ist abgeflacht, und so wirken die Blüten wie eine Geste des Loslassens und Empfangens.
Zusammenfassend kann man festhalten: Die Gundelrebe befreit vom Einzelkämpfertum. Sie hilft, die starre Idee loszulassen, alles aus eigener Kraft vollbringen zu müssen. Sie überlässt sich vertrauensvoll den schöpferischen und wundertätigen Kräften der Natur und nimmt deren Hilfe dankbar an.»
Wesen
«Die Gundelrebe steht in einer wesenhaften Beziehung zu den helfenden Naturkräften und -wesen. Sie besitzt eine Resonanz mit diesen Wesen und wirkt dadurch als ihr Verstärker. Um einen Gundelrebenbestand spüren wir höchste Lebendigkeit.
Die Gundelrebe weckt das Vertrauen in die Selbstheilungskräfte, in den eigenen Arzt in unserem Innern. Sie öffnet die Augen für die Einsicht, dass wir nicht alles selbst tun müssen, dass – wenn wir uns dafür öffnen – die Hilfe schon da ist. Das Wesen der Gundelrebe greift nie forcierend ein. Es verkörpert Gelassenheit, Geduld, innere Ruhe und das Vertrauen auf die helfenden Naturkräfte. Die Gundelrebe stärkt den Menschen in seinem Glauben an das Wunderbare, an das Leben selbst.
Die unscheinbare, zwerghafte Gestalt der Gundelrebe trägt ein höchst lebendiges Licht- und Wärmewesen in sich, das die durch innere Kälte gestockten und erstarrten Prozesse wärmend zu durchdringen und neu zu beleben vermag. Die Gundelrebe vermittelt das lösende Vermögen, Zustände, die – bewusst oder unbewusst – festgehalten wurden und dadurch nicht mehr im lebendigen Prozess der fortwährenden Veränderung stehen, zu erneuern. So können seit langem erstarrte Prozesse wiederum in den Lebensfluss aufgenommen werden. Gundelrebe beendet Winterstarre und Dunkelheit durch lösende Wärme- und Lichtkräfte und lässt so neue Lebensenergie durch die Adern fließen.»
Botanik
Der Gundermann (Glechoma hederacea L.) gehört zur Familie der Lippenblütler (Lamiaceae), die zumeist durch einen intensiven Duft ausgezeichnet sind. Einen intensiven Duft hat der Gundermann auch, sein Aroma ist aber ganz anders als die leichten ätherischen Düfte anderer Lippenblütler. Als erdig, warm und würzig kann man dieses Aroma beschreiben. Glechoma hederacea L. wird zwischen 10 und 40 cm gross und ist eine typische Pflanze des Frühjahrs. An seinem vierkantigen Stängel stehen seine kreuzgegenständigen, nierenförmig bis herz-eiförmigen Blätter. In den Blattachseln dieser rundlich geformten Blätter erscheinen in den Monaten März bis Mai die grossen, bis 3 cm langen, blauvioletten Blüten. Nach der Blütezeit beginnt der Gundermann lange Ausläufer zu treiben, die langsam und ausdauernd die Umgebung erobern und freien Boden wie mit einer lebendigen Haut aus Pflanzen überziehen. Erst im nächsten Frühjahr beginnt er dann wieder nach oben zu treiben und bildet erneut die prächtigen Blüten aus, die die Insektenwelt und uns erfreuen.
Verwendung
Die Anwendung der Gundelrebe, Glechoma hederacea L., ist insbesondere in der traditionellen Volksheilkunde sehr weit verbreitet. So wird der Gundelrebe eine entzündungshemmende Eigenschaft zugesprochen, die man sich in der Behandlung von Magen-Darmkatarrhen, Durchfall, Erkrankungen der oberen Bronchien (auch symptomatisch bei Husten), sowie Blasen- und Nierensteinen zu Nutzen macht. Die heilige Hildegard von Bingen schrieb, dass der Mensch, dem es an Kräften mangelt, in warmem Wasser mit der Beigabe von Gundermann baden soll, oder diesen den Mahlzeiten beifügen soll. Des Weiteren setzte sie Ihn bei Ohrgeräuschen, Brustschmerzen und Lungenbeschwerden ein. Für die Durchführung von Frühjahrskuren zur Reinigung und Entschlackung des Körpers über die Anregung des Gesamtstoffwechsels nach den kalten Wintermonaten ist Glechoma hederacea L. ebenfalls geeignet. Hieronymus Bock, einer der Väter der Botanik, nennt die Gundelrebe als ein harntreibendes, Leber und Milz öffnendes Mittel. Der Kräuterpfarrer Sebastian Kneipp nennt als Anwendung die Verschleimung der Lunge, des Magens und der Nieren.
Inhaltsstoffe
Die Gundelrebe, Glechoma hederacea L., enthält ätherisches Öl. Des Weiteren sind Sesquiterpenoide, Zimtsäurederivate, Flavonoide, Gerbstoffe und Triterpencarbonsäuren enthalten. Alles zusammen ergibt ein erdiger, würzig-krautiger Geruch, der sehr charakteristisch für diese Heilpflanze ist.
Referenzen
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Hänsel, R., Keller, K., Rimpler, H. & Schneider, G. Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis Band 5 Drogen E-O. (Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1993, 1993).
- BGA/BfArM (Kommission D). Glechoma hederacea. Bundesanzeiger 109 a, (1987).
- Riha, O. Hildegard von Bingen – Werke- Band V- Heilsame Schöpfung – Die natürliche Wirkkraft der Dinge – Physica – Vollständig neu übersetzt und ein geleitet. (Beuroner Kunstverlag (Abtei St. Hildegard, Rüdesheim/Eibingen), 2016).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil




HAFER
Avena sativa L.
WESEN: Belastbarkeit, Auffangen von Erschütterungen, Stabilisierung von Rhythmen
Wesen und Signatur
Signatur
«Der Hafer, zur Familie der Gräser (Graminaceae) gehörend, ist eine äusserst bewegliche und elastische Pflanze; alles Starre ist ihm fremd. Vergleichen wir ihn mit anderen Getreidepflanzen wie Gerste, Roggen oder Weizen, fällt uns ein grosser Unterschied in der Anordnung der Blüten bzw. Früchte auf. Die Früchte dieser Getreidearten sitzen dicht am Stengel und bilden eine kompakte Ähre. Wie anders gebärdet sich da der Hafer. Seine Blüten bzw. später die Früchte hängen an feinen, filigranen Stielchen. Wenn ein Haferfeld im Wind wogt, beginnen die feinen Blüten in einer zweiten, zusätzlichen Schwingung leise zu vibrieren und eine stille Melodie zu spielen. Dies ist möglich, weil die Blüten nicht starr am Stengel befestigt, sondern an sehr dünnen Blütenstielen beweglich aufgehängt sind. Wie muss ein Gebäude konstruiert sein, um starke Erschütterungen aufzufangen, also etwa ein Bau in einem erdbebengefährdeten Gebiet? Starre Konstruktionen taugen hier wenig, gefordert ist eine Bauweise, die die Energie von Erschütterungen absorbieren kann. So ist auch der Blütenstand des Hafers aufgebaut. Das Wesen seiner Konstruktion ist das Tragen von oben wie bei einer Hängebrücke. Zum Vergleich wären die anderen Getreidearten dann Brücken, die auf festen Pfeilern abgestützt sind. Der inneren Wahrnehmung erschliesst sich der Hafer als ein Kraftliniensystem aus einer tragenden Bogenkonstruktion mit aufgespannten Saiten – wie bei einer Harfe. Hafer – Harfe, die Ähnlichkeit der Begriffe ist gewiss kein Zufall. Die Pflanze Hafer und das Instrument Harfe besitzen eine Wesensverwandtschaft.»
Wesen
«Es ist das Wesen des Hafers, die Energie von Einflüssen, die uns aus dem Rhythmus bringen können, zu absorbieren. Diese liegen dann vor, wenn wir uns bedrängt oder gejagt fühlen, sei es durch schwer zu bewältigende Aufgaben, Arbeiten unter Zeitdruck, Bedrängnis oder Erschütterungen. Hafer fängt Erschütterungen auf und fördert dadurch die Belastbarkeit. Er unterstützt die seelische Bewältigung von äußerem Druck wie auch von großer körperlicher Erschöpfung. Unsere Zeit ist gekennzeichnet von schnell wechselnden Anforderungen, Anweisungen, Vorschriften und Arbeitsabläufen und nicht zuletzt von sich jagenden Bildern. Kaum ist etwas entstanden, wird bereits eine Umstrukturierung, eine »Verbesserung« angestrebt. Für viele Menschen ist dies die Realität ihres Arbeitsalltags. Bei nervösen Erschöpfungszuständen und beim Verlust des Rhythmus aufgrund der genannten Situationen oder nach zehrenden Krankheiten wirkt Hafer nervenstärkend und vermag den gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus wieder einzupendeln. Seelische Energie – die Voraussetzung für die Belastbarkeit in schwierigen Situationen – fließt uns nur dann zu, wenn verschiedene Tätigkeiten in einem bestimmten Rhythmus ausgeführt werden. Die Aufgaben müssen innerhalb einer angemessenen Zeit (nicht zu kurz und nicht zu lange) zu Ende geführt werden können. In dieser Hinsicht ist der Mensch in die natürlichen Rhythmen eingebunden. Steht der Rhythmus des menschlichen Alltags nicht mehr in Resonanz dazu, entsteht ein großer Energieverlust, eine Zerrissenheit, Stress. Der Mensch wird – bildlich gesprochen – durchs Leben gejagt. Feinfühlige Menschen reagieren in besonderem Maße auf diese Situationen. Hafer vermag durch sein stabilisierendes Wesen einerseits die Belastbarkeit zu erhöhen und andererseits das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass man sich oft selbst einer unnötigen Beunruhigung und Hektik ausliefert, indem man sich in den Strudel der vielfältigen Angebote ziehen lässt. Bei einer bewussten Wahl und allenfalls auch einem Verzicht kann sich im menschlichen Wesen wieder eine unerschütterliche Ruhe verankern. Dies bezieht sich auch auf eine eventuell vorliegende Suchtproblematik.»
Botanik
Der Hafer (Avena sativa L.) gehört zu Familie der Süssgräser (Poaceae). Er wird 60 – 150 cm hoch. Seine lineal-lanzettlichen Blätter umfassen den Stängel und werden bis 450 mm lang. Die Blätter fühlen sich fein-rau an. Der Hafer blüht in den Monaten Juni bis August. Im Gegensatz zu anderen Getreidenarten ist sein Blütenstand anders angeordnet: Die Blüten des Hafers stehen in einer Rispe, mit frei beweglichen und hängenden Blüten zusammen. Die Blüten der anderen Getreidesorten hingegen sind eng am Halm, in Form einer Ähre angeordnet. Das eigentliche Herkunftsgebiet der Pflanze ist nicht sicher bekannt, heute wird Hafer weltweit angebaut. Der Hafer wächst auch auf eher ungünstigen Standorten und liefert selbst hier gute Erträge. Er durchwurzelt den Boden intensiv und befestigt diesen somit, hierdurch dient er als Erosionsschutz.
Verwendung
Das Wort «Avena» soll aus dem Sanskrit «avasa» stammen, was «Nahrung» bedeutet. Aus diesem Grund verwundert es nicht, dass der Hafer insbesondere im Mittelalter eine der wichtigsten Getreidearten war. Seine große Bedeutung als gesundheitsförderndes Nahrungsmittel wurde auch von Paracelsus und vom Kräuterpfarrer Sebastian Kneipp betont. Darüber hinaus gelten arzneiliche Zubereitungen aus Hafer als ein ausgleichendes Tonikum für das Nervensystem. Deshalb kann der stärkende Hafer in allen Altersgruppen bei den Folgen von Stress und Überarbeitung eingesetzt werden. Die kräftigenden Eigenschaften dieser Getreideart erklären auch seinen Einsatz in der Phase der Rekonvaleszenz nach erschöpfenden und auszehrenden Krankheiten. Traditionell wird der Hafer auch bei Stimmungsschwankungen und leichten Schlafstörungen angewendet. In der Literatur finden sich auch Hinweise auf die Möglichkeit Hafer zur unterstützenden Begleitung von Menschen mit Suchtproblemen einzusetzen.
Inhaltsstoffe
Hafer enthält verschiedene Zucker, stickstoffhaltige Säuren (Aveninsäuren), und glycosylierte Steroidsaponine (Avenacoside). Daneben kommen auch Flavonoide und Mineralstoffe vor.
Referenzen
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment report on Avena sativa L., herba and Avena sativa L., fructus. (2008).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Community Herbal Monograph on Avena sativa L., herba. Eur. Med. Agency (2008).
- BGA/BfArM (Kommission D). Avena sativa. Bundesanzeiger 190a, (1985).
- Vonarburg, B. Homöothanik – Arzneipflanzen der Homöopathie. (Haug Verlag, 2009).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil




HIRTENTÄSCHEL
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
WESEN: Bewahren, Einschränken, Umfassen der Lebenskraft
Wesen und Signatur
Signatur
«Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich Signatur und Wesen des Hirtentäschels verstanden habe. Während Jahren habe ich sie immer wieder intensiv studiert, um ihr Geheimnis zu ergründen. Die Signaturenlehre ist nichts Schematisches, bei dem man nach bestimmten Regeln vorgehen kann. Es gibt keinen Katalog mit Angaben über die Bedeutungen verschiedener Pflanzenformen. Der erste Schritt ist immer die seelische Verbindung mit einer Pflanze, indem man sich ihrer Ausstrahlung öffnet. Das Hirtentäschel hat mich aber völlig irritiert, weil es die einzige Pflanze war, bei der ich einfach keine Ausstrahlung wahrnehmen konnte. Ich habe die Pflanze stundenlang betrachtet und auch mit dem Mikroskop in allen Varianten untersucht, konnte aber nichts Bedeutsames finden. Bis ich eines Tages erkannte: Das Hirtentäschel hat gar keine Ausstrahlung, sondern es strahlt nach innen. Und dann verstand ich seine Signatur und sein Wesen. In der Elektrotechnik kennen wir Antennen. Sie können elektromagnetische Strahlung empfangen oder ausstrahlen. Dies ist in der belebten Natur genauso. Auch hier gibt es «Antennen», lange Dornen oder Haare zum Beispiel. Sie sind in der Lage und haben die Aufgabe, Strahlung – in diesem Fall Lebensenergie – aufzunehmen oder abzustrahlen. Um eine zielgerichtete Bewegung grafisch zum Ausdruck zu bringen, zeichnen wir einen Pfeil. Die Spitze eines Pfeils zeigt immer in die Richtung der Bewegung oder Strahlung. Auch in der Natur gibt es Pfeile, allerdings viel seltener als Antennen. Ein solches Beispiel ist nun das Hirtentäschel. Betrachten wir einmal die Form der Fruchtschoten. Es sind Pfeile, die nach innen, zur Pflanze hin gerichtet sind. Nach innen gerichtete Pfeile sind eine sehr grosse Ausnahme. Diese Pfeile deuten an, in welche Richtung die Lebenskräfte des Hirtentäschels strömen. Beim Hirtentäschel haben wir also keine Ausstrahlung wie bei allen anderen Pflanzen, die mit ihren ausstrahlenden Kräften nach aussen hin kommunizieren, sondern der Fluss der Kräfte strömt in der Gegenrichtung. Das heisst, das tiefste Wesen dieser Pflanze besteht darin, auch nur den geringsten Verlust an Lebenskraft möglichst zu vermeiden. Aus dieser Wesensart lässt sich die blutstillende Wirkung bestens verstehen, denn Blut ist pure Lebenskraft.»
Wesen
«Hirtentäschel ist eine Pflanze von intensiv vibrierender innerer Lebendigkeit, die sie jedoch nach außen hin weder durch Farbe noch durch Ausstrahlung zum Ausdruck bringen kann. Es gehört zum Wesen des Hirtentäschels, seine Lebenskräfte zu umfassen und im Innern festzuhalten, um dadurch einen Verlust zu verhindern. Das Wesen dieser Pflanze könnte man als das Gegenteil von charismatisch bezeichnen. Es ist konservativ, also bewahrend und fällt mit ihren Lebensäußerungen nie aus dem Rahmen. Hirtentäschel ist eine Pflanze für Menschen, die sich oft zu stark verausgaben, indem sie aus ihrem persönlichen Rahmen fallen. Den dadurch hervorgerufenen Verlust an Lebensenergie kann man auch mit einer Blutung vergleichen. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. ist also eine Pflanze, die äußerst spezifisch gegen körperliche und seelische Arten des Blutverlustes wirksam ist.»
Botanik
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., das Hirtentäschel, ist eine Pflanze die zu den Kreuzblütengewächsen (Brassicaceae) gehört und etwa 10 bis 70 cm hoch wird. Ihre grundständigen Blätter, die in einer Rosette angeordnet sind, können sehr vielgestaltig hinsichtlich ihrer Grösse und Form sein. Die Stängelblätter hingegen sind deutlich kleiner und lanzettlich geformt. Die Pflanze kann über das ganze Jahr blühen. Ihre langgestielten weissen Blüten stehen zunächst als Knospen gedrängt zusammen und strecken sich dann während des Erblühens und Fruchtens in die Länge. Die Blüten sind weiss gefärbt und nur 2 bis 3 mm lang, sie bestäuben sich vorwiegend selbst. Die charakteristischen Früchte der Pflanze sind verkehrt-herzförmig, sie sind mit der Spitze zum Stängel hin angeordnet. Ihre typische Form, die an die Taschen von Hirten erinnert, hat der Pflanze ihren Namen gegeben. Voller Vitalität kann das Hirtentäschel bis zu 4 Generationen im Jahr hervorbringen. Die Samen bewahren diese Vitalität, sie bleiben bis zu 30 Jahre im Boden keimfähig. Das Hirtentäschel besiedelt vor allem Äcker, Brachen und Gärten, man findet es aber auch an Wegrändern.
Verwendung
Bereits Paracelsus kannte das Hirtentäschel und stufte es als «Constrictivum» ein. Dieser Begriff ist lateinischen Ursprungs und bedeutet frei übersetzt, dass es sich um ein «zusammenziehendes Mittel» handelt. Die blutstillende Wirkung von Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.ist folglich schon seit Jahrhunderten bekannt und wird in der einschlägigen, naturheilkundlichen Fachliteratur ausführlich beschrieben. Traditionell haben sich vor allem die Zubereitung als Kräuterteeaufguss und die Verwendung von alkoholischen Tinkturen durchgesetzt. Gerade in der Frauenheilkunde kommt das Hirtentäschel regelmäßig zum Einsatz. Insbesondere bei zu starker und zu langer Menstruationsblutung, die in manchen Fällen die Begleiterscheinung von Uterus-Myomen sind. Auch nach der Geburt, nach operativen Eingriffen und bei Nasenbluten kann diese Heilpflanze bei anhaltender Blutungsneigung eingesetzt werden. Je nach Lokalisation der Blutungsbeschwerden wird die innerliche Anwendung (oral) oder die äußerliche Anwendung (topisch) gewählt. Eine weitere traditionelle Form der Anwendung von arzneilichen Zubereitungen aus Hirtentäschel sind Nierenbeschwerden, insbesondere wenn diese mit der Bildung von Konkrementen (Sand, Griess und Steinen) im Urogenitaltrakt einhergehen.
Inhaltsstoffe
Capsella bursa-pastoris L. enthält Acetylcholin, Cholin, Diosmin, Tyramin, Histamin, Gerbstoffe und ein wenig ätherisches Öl. Weitere Inhaltsstoffe sind Saponine, Flavonoide, Vitamin C und Mineral-salze, darunter vor allem ein hoher Gehalt an Kalium.
Referenzen
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment report on Capsella bursa-pastoris ( L .) Medikus , herba (EMA/HMPC/262767/2010). (2011).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil




HOLUNDER
Sambucus nigra L.
WESEN: Reifung, Vollendung von Wärmeprozessen, Erwachsenwerden, Verantwortung, Schutz
Wesen und Signatur
Signatur
«Der Holunder beginnt sich im Frühjahr als einer der ersten Sträucher unserer Wälder zu regen. Aus Stamm und Zweigen schiessen neue Triebe senkrecht nach oben und strecken sich in kurzer Zeit zu einer beachtlichen Länge. So überschiessend ist ihr Wachstum, dass die Borkenbildung nicht Schritt halten kann; mit einer blattartig grünen, dünnen Rindenhaut sind die jungen Triebe vorerst nur dürftig geschützt. Der Geruch dieses jungen, ungestüm treibenden Lebens ist, wie auch derjenige der Blätter, eigenartig brenzlig, unvollendet. Er erinnert an mottendes Feuer, dem es an ausreichendem Luftzug, an Sauerstoff fehlt.
Ein Jahr später hat sich das Jungholz äusserlich gefestigt, die Borke ist ausgebildet, und nun beginnen sich die Zweige leicht zur Erde hin zu biegen. Betrachten wir das Innere der Äste, indem wir mit einem Messer Schicht um Schicht des Holzes abschälen, entdecken wir ein schwammig poröses, leichtes Mark. Der Vergleich mit Styropor drängt sich auf. Der Holunderzweig ist in seinem Mark also reichlich luftdurchdrungen. Sind dies nicht eigenartige Zusammenhänge? Im Mark finden wir Lufteinschlüsse, während der Geruch der Blätter und jungen Triebe an einen Verbrennungsprozess mit ungenügender Luftzufuhr erinnert. Im weiteren Wachstum biegen sich die Zweige immer weiter nach unten. Bei älteren Sträuchern finden wir die Äste manchmal zu schön ausgeprägten Bogentoren geformt. Am Scheitel solcher Tore steigen immer jüngere Äste auf, die sich später ebenfalls zu Bogen formen, so dass oft mehrere gebogene Äste übereinander liegen. So finden wir im Holunder den Ausdruck grüner, aufstrebender Lebenskraft, die von der Erdenschwere erfasst wird, sich neu formt, nach oben reckt, um dann wieder nach unten gezogen zu werden. Die Rinde eines alten, reifen Holunders sieht zerschlissen und greisenhaft aus. Es ist wohl kein grösserer Gegensatz vorstellbar zwischen der grünen Haut der jungen Zweige und der zerfetzten grauen Borke des alten Stamms. Doch der Holunder ist nicht krank, neue Triebe spriessen wie eh und je, er sieht nur sehr alt aus. Im Frühling bringt der Holunder eine reiche Blütenpracht hervor. Die weissen Dolden (es sind Trugdolden) sind oft leicht konkav, wie empfangende, nach oben gerichtete Parabolspiegel, was für Dolden ganz ungewöhnlich ist. Die kleinen Einzelblüten sind wie blinkende, weisse Sternchen, die die übervollen gelbgoldenen Staubbeutel umschliessen. Kaum eine andere Pflanze produziert so grosse Mengen an Blütenpollen. Trocknet man beispielsweise Holunderblüten auf einem weissen Tuch oder Papier, ist dieses übersät mit einer Schicht aus gelbem Pollenpulver, das an feuriges Schwefelpulver erinnert.
Der Blütenduft ist geheimnisvoll süsslich, er trägt unsere Seele in andere Welten. Wenn wir die Tiefe des Holunderdufts ergründen möchten, muss es in den Abendstunden eines schönen Frühsommertags geschehen. Dann ist der Duft am stärksten. Im Herbst hängen die Früchte schwer am Strauch. Ihre Farbe ist schwarz wie die Nacht, der Geschmack säuerlich herb.
Was hat uns all dies zu sagen? Das Hauptthema, das sich wie ein roter Faden durch die Signatur des Holunders zieht, ist das Thema der Lebensenergie, die sich in den Dienst eines geistigen Reifungsprozesses, eines Wärmeprozesses stellt. Es liegt in der Natur des Lebens: erwachsen werden, Verantwortung übernehmen und vor allem geistige Reife erlangen ist nur in dem Masse möglich, wie sich die Lebensenergie transformieren kann und nicht mehr im vollen Übermut der Jugend ausgelebt wird. Dies führt notwendigerweise dazu, dass die jugendliche Vitalität abnimmt und sich ein Älter- und Reiferwerden in jeder Hinsicht einstellt. Ein geistig-seelischer Entwicklungsprozess erfordert auch immer wieder eine Neuorientierung, ein Verlassen von Konzepten und Zielen. Denn jede Entwicklung auf einer bestimmten Bahn, so gut sie zu Beginn auch sein mag, verliert nach einer gewissen Zeit an Kraft und wird negativ – sie biegt sich zur Erde hin. Darum muss auf dem Höhepunkt einer Entwicklung die alte Bahn verlassen und ein neuer Weg eingeschlagen werden. Nur so kann von wirklichem innerem Fortschritt die Rede sein. Dies zeigt uns der Holunder in eindrücklicher Weise.
Das Märchen «Frau Holle» der Gebrüder Grimm gibt uns ein vollkommenes Bild vom Wesen des Holunders (Holler). Nachdem die Hauptfiguren durch den Brunnenschacht zu einer tieferen Ebene (Ebene der seelischen Transformation) hinabgetaucht sind, müssen sie zunächst einen Reifungsprozess vollenden (gebackene Brötchen aus dem Ofen nehmen, reife Äpfel pflücken). Danach müssen sie ihre Lebenskraft in den Dienst von Frau Holle stellen, damit ihr Geist zur Klarheit kommt (Schnee auf der Erde). Wer diese Lebensaufgabe selbstlos und mit Hingabe erfüllt, wird mit geistigem Gold beschenkt, wer sie widerwillig und nur der Belohnung wegen ausführt, wird mit dem klebrigen Pech der Verstrickung ins Schicksal übergossen.
Der Holunder gehört zu den grossen Mysterienpflanzen. Er ist das äussere Sinnbild für eine wahrhaft geistige Entwicklung. In früheren Einweihungsschulen war die Pflanze denn auch ein wichtiges Symbol für den Weg zum höchsten Ziel, das ein Mensch je erreichen kann.»
Wesen
«Der Holunder ist die Schutzwesenheit für die Werke zur Veredlung und Vervollkommnung von Natur und Mensch. Das wesentliche Element, das dem Menschen zu kultureller und geistiger Höherentwicklung geschenkt wurde, ist das Feuer. Jeder Veredlungsprozess ist letztlich ein Wärme- und Bewusstwerdungsprozess. Dazu muss das Feuerelement im richtigen Maß eingesetzt werden, indem das Luftelement richtig dosiert und geregelt wird. Das Holunderwesen repräsentiert jene Kraft, die den richtigen Gebrauch, die richtige Handhabung der Luft (des Atems) und des Feuers ermöglicht. Es ist das geistige Prinzip, das die richtige Wärmetönung ermöglicht, damit die menschlichen Werke – sowohl die äußeren als auch die inneren Bewusstseinswerke – zu ihrer Vollendung kommen können.
Die Kraft des Holunders drängt den Menschen zu dem, was er werden soll, zur Vervollkommnung, zur seelischen und geistigen Höherentwicklung. Der Holunder lässt die Dinge ausreifen und erlaubt, sie zum richtigen Zeitpunkt zu ernten, er erlaubt, die nächste Stufe zu besteigen, ohne dass eine Stufe übersprungen wird. Der Holunder ist ein Bildnis für die Lebensaufgabe des Menschen. Seine Zweige wachsen gerade in den Himmel, um sich nach einer Zeit zurück zur Erde zu biegen. Er vergisst seine Wurzeln, seine Abstammung, nicht, er neigt sich zu allen, die mit ihm auf dem Weg sind. In seiner höchsten Blüte ist er in empfangender Geste nach oben geöffnet. Der Holunder bietet sich z.B. Menschen an, die sich ihrer Aufgabe noch nicht bewusst sind oder die eine eingeschränkte Vorstellung von ihrer Existenz, eine eigen sinnige Weltvorstellung haben. Sie beurteilen ihre Umgebung nach ihren Wertvorstellungen und lassen sich nicht leicht von ihrem Urteil abbringen. Es fehlt die Geste der Öffnung nach oben, die Öffnung für höhere Erkenntnis und umfassendere Zusammenhänge. Daraus können Erkrankungen der Atemwege entstehen, denn der Atem ist das Symbol für die geistige Verbindung mit Welt und Menschheit. Über den Atem stehen die Menschen in intimer Verbindung miteinander – «wir atmen einander ein». Wenn wir dies nicht zulassen, sind wir nicht mehr eingebunden ins Allgeschehen.
Einem eigensinnigen Menschen fehlt die Fähigkeit, ein Geschehen ausreifen zu lassen, einen Prozess zuzulassen. Er zieht voreilige Schlüsse und beharrt darauf, er erhitzt sich zu sehr für oder gegen etwas, Entstehungsprozesse geraten ins Stocken. Der ganze menschliche Lebenslauf ist ein Reifeprozess. Täglich, stündlich geschehen im Menschen körperliche und seelische Prozesse, größere und kleinere Zyklen, die einen Beginn, einen Höhepunkt und ein Ende haben. Solche Prozesse unterstehen ihrem eigenen zeitlichen Verlauf, ihrer eigenen Gesetzmäßigkeit. Der reife Mensch weiß darum und greift nicht ein, er überlässt sich der inneren Führung. Menschen jedoch, die übereifrig und zu emotional sind, greifen überall ein, bei sich und bei anderen, bringen Prozesse ins Stocken oder unterbrechen sie gar. Dies wirkt krankmachend, abwehrschwächend. Holunder kann mit seinem Prinzip der Reife helfend eingreifen und das Weiterschreiten ermöglichen. Es ist der Prozess der Reifung, des Erwachsenwerdens, der Übernahme von Verantwortung. Holunder unterstützt die Vollendung seelischer und körperlicher Reifungsprozesse und besitzt eine ausgeprägte Beziehung zu den durchlüfteten Organen (Atemwege und Nebenhöhlen). Er wird eingesetzt bei stockenden – nicht zur Vollendung kommenden – Wärmeprozessen, wenn zum Beispiel eine Entzündung lange nicht ausheilt oder zur Chronifizierung neigt. Entzündungen und hartnäckige Verschleimung im Bereich der Atemwege, chronische Sinusitis und Raucherhusten sprechen gut auf Sambucus an.
Botanik
Der Schwarze Holunder (Sambucus nigra L.) ist ein reich verzweigtes, strauch- oder auch baumförmiges Gehölz. Er ist in ganz Europa verbreitet und besiedelt feuchte Wälder sowie Wald- und Wegränder. Er kann bis 10 m hoch werden und bevorzugt nährstoffreiche Orte. Seine jungen Zweige sind grün und mit zahlreichen grauen, warzigen Punkten bedeckt, welche dem Gasaustausch dienen. Die jungen Triebe wachsen zunächst rasch nach oben und können so mehr als 1 Meter im ersten Jahr in die Höhe schiessen. Die Rinde der älteren Zweige hingegen ist ganz anders gestaltet, sie ist graubraun und wird tief rissig. Das Innere der Zweige ist erfüllt von einem weissen, luftigen Mark. An den Zweigen stehen die, bis 30 cm langen, unpaarig gefiederten grünen Blätter. Blätter und Rinde entwickeln einen unangenehmen Geruch beim Verreiben. Ab Juni bilden sich die gelblichweissen Blüten des Holunders, die in schirmförmigen Blütenständen zusammenstehen. Die Blüten duften intensiv süsslich und sondern viel gelblichen Pollen ab, der ein samtiges Gefühl auf der Haut hinterlässt. Nach der Befruchtung reifen dann, bis in den Herbst hinein, die schwarzen Beeren heran.
Verwendung
Der Holunder ist eine feste Säule der Traditionellen Europäischen Medizin. Die heilkundliche Tradition reicht bis zu Hippokrates und Paracelsus zurück. Eine der bekanntesten Eigenschaften der Holunderblüten ist die diaphoretische (schweißtreibende) Wirkung. Die Anwendung als schweißtreibendes, diuretisches und bronchialsekretorisches Mittel bei Erkältungskrankheiten hat sich in der Pflanzenheilkunde bewährt. Auch in der Homöopathie wird der Holunder erfolgreich bei Entzündungen der Atemwege eingesetzt. Somit gehören zu den typischen Anwendungsgebieten des Holunders die Erkältungskrankheiten, leicht fieberhafte Affektionen, Erkrankungen der Respirationsorgane, Laryngitis, Bronchitis, Husten und Schnupfen.
Inhaltsstoffe
Typische Inhaltsstoffe des Holunders, Sambucus nigra L., sind ätherisches Öl und Flavonoide. Zu den weiteren Inhaltsstoffen zählen Sterole und Triterpene, Phenolcarbonsäuren wie Chlorogensäure, Schleimstoffe und Gerbstoffe. Insbesondere die Früchte enthalten zudem verschiedene Vitamine. In Spuren kann man potentiell giftige cyanogene Glykoside, wie Sambunigrin finden, die aber beim Kochen zersetzt werden.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- Wichtl, M. et al. Teedrogen und Phytopharmaka. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 1997).
- Hänsel, R., Keller, K., Rimpler, H. & Schneider, G. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis Band 5 Drogen P-Z. (Springer Verlag Berlin Heidelberg, 1994).
- 4. Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment report on Sambucus nigra L ., flos. EMA/HMPC/611504/2016 (2018).
- BGA/BfArM (Kommission E). Sambuci flos (Holunderblüten). Bundesanzeiger 50, (1986).
- BGA/BfArM (Kommission D). Sambucus nigra. Bundesanzeiger 54a, (1989).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil

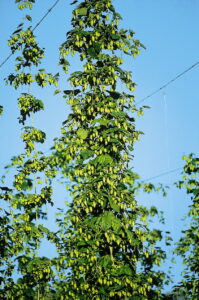
HOPFEN
Humulus lupulus L.
WESEN: Rückzug, Fröhlichkeit, Leichtigkeit
Wesen und Signatur
Signatur
«Der Hopfen ist eine Schlingpflanze, die bis zu 8 m hoch wird. Die Pflanze ist zweihäusig, das heisst, es gibt weibliche und männliche Pflanzen. Der angebaute Hopfen ist ausschliesslich weiblich, da für die Herstellung von Bier oder Heilmitteln die weiblichen Fruchtstände, die Hopfenzapfen kurz vor der Reife verwendet werden. Der gelblich grüne, hängende Fruchtstand ist eiförmig und besteht äusserlich aus 1 bis 2 cm langen Deckblättern (Schuppen), die sich dachziegelartig decken. Die Innenseiten der Deckblätter sind übersät mit kleinen, glänzenden, hellgelben Drüsenschuppen. In diesen Drüsen sind die Wirkstoffe enthalten: das bitter schmeckende Harz und das aromatisch riechende ätherische Öl. Wenn im Spätsommer der Hopfen zur Verarbeitung in unserem Labor ankommt, ist dies immer ein sehr freudiges Ereignis, denn gute Laune und Unbeschwertheit sind in der Lieferung mit inbegriffen. Ein Sack frischer Hopfen verbreitet einen wunderbaren, süsslichen Duft, der sofort auf die Psyche wirkt; Fröhlichkeit und Leichtigkeit breitet sich aus, und die Menschen fühlen sich miteinander verbunden. Die Schuppen des Panzerhemds unserer Persönlichkeit, mit dem wir uns oft innerlich abschotten, fallen wie von selbst ab und lassen uns aufeinander zugehen.
Auch der dachziegelartige Bau der Hopfenzapfen ist etwas Besonderes und Geheimnisvolles. Frische Hopfenzapfen sind fein, leicht, weich und doch kompakt; sie verheissen ein reiches Innenleben, Fülle und Fruchtbarkeit. Man möchte die Zapfen berühren, sie öffnen, zerpflücken – sie sind einfach unglaublich anziehend.
Die Hopfenzapfen sind weiblich und eiförmig. Sie verheissen Leben und Fruchtbarkeit. Es ist Leben in der Vereinigung, in der Symbiose; viele kleine Schuppen sind es, die das Ei bilden. Die Hopfenzapfen lassen an die Kindheit denken, an die Unbeschwertheit und die Symbiose mit der Mutter. Der Hopfen ist eine nährende Pflanze; er nährt nicht mit Kalorien, sondern mit Lebenskräften. Im Bier werden die Kalorien vom Malz und vom Alkohol geliefert, und so ist dieses beliebte Getränk ein wunderbares Mittel, um Geborgenheits- und Verschmelzungsgefühle aufkommen zu lassen, wie sie in der Kindheit selbstverständlich waren. Da die lieblich einlullende und nährende Wirkung des Hopfens auf der psychischen Ebene stattfindet und dort das Verlangen nach Verschmelzung teilweise befriedigt, wird der Geschlechtstrieb – das Verlangen nach körperlicher Verschmelzung – abgeschwächt. Hopfen ist von alters her ein Mittel zur Dämpfung eines übersteigerten männlichen Geschlechtstriebs.
Zu erwähnen ist noch die Tatsache, dass die Hopfenpflanze rechtswindend ist. Dies ist eine Seltenheit, denn die meisten Schlingpflanzen sind linkswindend. Der Drehsinn von Spiralformen hat eine wichtige energetische Bedeutung; linksdrehende Spiralen führen Kräfte aus der Materie hinaus, und rechtsdrehende Windungen begleiten die Materialisierung von Kräften. So wird durch die Rechtsdrehung das mütterliche, symbiotische Wesen des Hopfens zusätzlich unterstrichen.»
Wesen
«Der Hopfen ist eine Pflanze, die den Rückzug symbolisiert. Sein Wesen ist nicht darauf gerichtet, Ideen umzusetzen und Energien anzuwenden. In der Ruhe und Abgeschiedenheit oder im geschützten Kreis Gleichgesinnter schweifen die Gedanken, ohne konkret schöpferisch wirksam zu werden. Hat man in der Arbeit oder im Leben überhaupt seine Energie, sein Engagement gegeben, folgt nun die Umkehrung am Feier- oder Lebensabend. Nach vollendetem Tagewerk darf man sich nun entspannen. Die Energien können in die umgekehrte Richtung fließen, man ist auf Empfangen, auf Regeneration eingestellt. Das Hopfenwesen schirmt sich ab von störenden Einflüssen, die einen in den Alltag zurückholen; entweder durch Rückzug in «klösterliche» Einsamkeit oder in der Abgeschlossenheit eines Kreises von Freunden. Die Gedanken steigen kreisend in die Höhe, entfernen sich von den Pflichten und Verantwortungen, möchten sich aus der Realität herausziehen. Durch die Distanz können sich Spannungen und Unruhe lösen, das Gemüt wird fröhlich und leicht.
Das Wesen des Hopfens hilft Menschen, die eher am Stoffwechselpol verhaftet sind und zu einer gewissen Erdenschwere neigen, die tagsüber schläfrig sind und nachts wach liegen. Durch die Einnahme von Hopfen verlieren sie das Schwerfällige, Schläfrige und erfahren nachts eine lösende Ruhe.
Hopfenzubereitungen können aber auch umgekehrt wirken. Menschen, deren Aktionskreis kleiner geworden ist infolge Altersbeschwerden oder Krankheit haben oft Mühe, sich umzustellen. Sie fühlen sich innerlich noch ganz aktiv, werden aber von außen durch ihre Behinderung oder durch ihr Alter begrenzt. Dadurch entsteht Spannung und Unruhe. Ebenso fühlen sich viele junge Menschen energiegeladen und verlangen danach, aktiv zu werden; ihr Aktivitätspotenzial besitzt aber noch kein oder ein ungenügendes Profil. Sie müssen lernen, sich unterzuordnen, und erfahren dadurch Begrenzung; es entsteht Spannung. In vielen Lebenssituationen muss der richtige Zeitpunkt abgewartet werden, um handeln zu können. Dabei besteht die Gefahr, dass man die Geduld verliert, pessimistisch oder aggressiv wird. Durch eine Veränderung ist man aus einem Lebensbereich herausgewachsen, man steht «auf dem leeren Bahnsteig am richtigen Geleise» und wartet. Die neue Situation kündigt sich an, ist aber noch nicht konkret vorhanden. Nun ist es wichtig abzuwarten, die Spannung auszuhalten.
Die Wesenskraft des Hopfens hilft, die erwähnten Spannungen dadurch aufzulösen, dass sie das kreative Potenzial in die richtigen Wege leitet. Durch diese Entspannung kann der richtige Schlafrhythmus wieder gefunden werden.»
Botanik
Humulus lupulus L., der Gewöhnliche Hopfen, ist ein ausdauerndes Schlinggewächs, welches zur Familie der Hanfgewächse (Cannabaceae) gehört. In der Vegetationszeit kann der Hopfen bis 8 m lange oder sogar noch längere Triebe ausbilden, die mit Kletterhaaren besetzt sind und sich im Uhrzeigersinn, also rechtswindend, um ihre Unterlage winden. Dies kann man erkennen, wenn man von oben auf einen solchen Trieb herabschaut. Die meisten anderen Ranken die wir kennen, klettern hingegen linkswindend. Die langen Triebe des Hopfens werden jedes Jahr aufs Neue, ab April, aus dem unterirdisch liegenden Rhizom gebildet. Pro Tag können sie bis zu 10 cm wachsen! Kulturhopfen kann bis 50 Jahre alt werden. Seine grossen schönen Blätter stehen gegenständig am Stängel und sind 3 bis 5lappig. Sie sind dunkelgrün und rauhaarig, unterseits etwas heller und mit gelben Drüsen besetzt. Ab etwa Juli beginnt der Hopfen mit der Blüte. Hierbei fällt auf, dass es männliche und weibliche Pflanzen gibt. Die Blüten der männlichen Pflanzen sind unscheinbar und stehen in lockeren Rispen zusammen. Die weiblichen Blüten hingegen stehen in den bekannten eiförmigen, ährigen Kätzchen zusammen, die fast kein Eigengewicht zu haben scheinen. An diesen Kätzchen stehen die Deckblätter dachziegelartig zusammen und bilden den 2 bis 5 cm langen und 1 bis 2 cm breiten Fruchtstand aus. Die Innenseiten der Deckblätter sind übersäht mit kleinen, glänzenden und hellgelben Drüsenschuppen, die das bittere Hopfenharz enthalten. Die weiblichen Blütenstände verströmen einen typischen und intensiv würzigen Duft und haben einen sehr stark bitteren und langanhaltenden Geschmack.
Verwendung
Die Anwendung des bitteren Hopfens als Zusatz in Getränken – sei es zur Verbesserung der Haltbarkeit oder zum Aromatisieren – ist schon mindestens seit dem Mittelalter bekannt. Neben der Bierherstellung kann der Charakter des ätherischen Öls und der Bitterstoffe der jeweiligen Hopfenart auch medizinisch in der Dufttherapie seine Wirkung entfalten. Typisch für den Hopfen ist die beruhigende und schlaffördernde Wirkung. Auch die angstlösende und die in der Volksheilkunde beschriebene anaphrodisierende Wirkung wurde bereits untersucht. Zu den Anwendungsgebieten des Hopfens gehören daher Unruhe, Nervosität, Angstzustände und Schlafstörungen. Als Amarum aromaticum kann sich der Hopfen auch über die Bitterwirkung z.B. bei dyspeptischen Beschwerden als nützlich erweisen.
Inhaltsstoffe
Die Hopfenzapfen enthalten ätherisches Öl, welches ihnen den charakteristischen Geruch verleiht. Das ätherische Öl setzt sich hauptsächlich aus Mono- und Sesquiterpenen zusammen (z. B. Humulen und Caryophyllen). Daneben enthält Hopfen auch bitter schmeckende Humulone und Lupulone. Des Weiteren findet man unter anderem Flavonoide (z.B. Xanthohumol) und Gerbstoffe.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment Report on Humulus Lupulus L., Flos. EMA/HMPC/418902/2005 (2014).
- European Scientific Cooperative On Phytotherapy (ESCOP). ESCOP Monographs. (Georg Thieme Verlag, Rüdigerstrasse 14, D-70469 Stuttgart, Germany and Thieme New York, 333 Seventh Avenue, New York NY 10001, USA, 2003).
- Saller, R., Melzer, J., Uehleke, B. & Rostock, M. Phytotherapeutische Bittermittel. Schweizerische Zeitschrift fur GanzheitsMedizin 21, 200–205 (2009).
- BGA/BfArM (Kommission D). Humulus lupulus (Lupulus). Bundesanzeiger 172 a, (1988).
- Zanoli, P. et al. Experimental evidence of the anaphrodisiac activity of Humulus lupulus L. in naïve male rats. J. Ethnopharmacol. 125, 36–40 (2009).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2018).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil




JOHANNISKRAUT
Hypericum perforatum L.
WESEN: Lichtassimilation, Nervenkraft, Stabilität
Wesen und Signatur
Signatur
«Johanniskraut ist eine Pflanze des Mittsommers, sie blüht um den Johannistag (24. Juni). Sie gehört zur Familie der Hartheugewächse und wächst an Wegrändern, in Kahlschlägen, auf Brachwiesen sowie in Kiesgruben. Ihre auffallenden Merkmale sind die Stabilität des Stengels, die Lichthaftigkeit der Blüten, die «perforierten» ovalen Blätter und der in ihr enthaltene rote Farbstoff. Der Familienname Hartheugewächs sagt schon viel aus. Noch im Schnee des Winters stehen die starren, dürren Stengel des Johanniskrauts am Wegrand und wecken wehmütige Erinnerungen an vergangene Sommertage. Der Stengel ist fest und zweikantig (eine Seltenheit im Pflanzenreich) und strebt aufrecht mit einer leichten Spiralwindung und einem leichten Aufwärtsbogen (wie bei einer Wirbelsäule) zum Licht. Die zahlreichen kreuzweise gegenständig angeordneten, mehr oder weniger geradlinigen Seitentriebe sind schräg nach oben gerichtet, so dass jeweils zwei Seitentriebe ein auf die Spitze gestelltes, nach oben offenes gleichseitiges Dreieck bilden. Wie bei einer Figur, deren Arme empfangend schräg nach oben ausgestreckt sind. Lassen wir dieses Gerüst aus Stengel und Seitentrieben auf unser Gemüt wirken, so haben wir ein Bild von Stabilität und Gleichgewicht. Eine Waage, die sich im Gleichgewicht befindet. Dies gerade deshalb, weil wir im Gerüst eine hohe Ordnung, aber keine vollkommene Geradlinigkeit und Symmetrie finden. Alles ist leicht verdreht und gebogen und bringt so das Stabilitätsprinzip der Natur zum Ausdruck. Warum?
In der Natur herrscht ein weiser Plan, und alles ist nach einer bestimmten Ordnung gefügt. Wir finden in der belebten Natur Symmetrien, Zahlengesetzmässigkeiten, Kreisläufe, harmonikale Muster, Rhythmen, doch sie sind niemals mathematisch perfekt. Die mathematische Perfektion gehört in die Sphäre des Mineralischen, der Kristalle. Im Reich des Lebendigen bedeutet die absolute Ordnung Starre und Tod. Man weiss zum Beispiel, dass Patienten kurz vor einem Herzinfarkt einen Herzrhythmus haben, dessen Phasen absolut zeitgleich sind. Ein starres System kann nicht mehr reguliert werden und kippt bei der geringsten Störung.
Die goldgelben Blütenblätter des Johanniskrauts sind radiär symmetrisch, in einer Ebene ausgebreitet wie kleine Sonnenscheiben. Beim Anblick von oben fällt auf, wie sie von innen nach aussen verdreht sind. Die Johanniskrautblüten haben einen deutlichen Drehsinn und erinnern an kleine Windräder. In welche Richtung läuft die Drehung? Wir finden etwa in gleicher Zahl rechts- und linksdrehende Blüten – und dies ist eine Ausnahme im Pflanzenreich. Es gibt zwar andere Blüten, die ebenfalls einen Drehsinn haben, doch dieser läuft immer nur in dieselbe Richtung. Oleanderblüten zum Beispiel sind immer rechtsdrehend und Immergrünblüten immer linksdrehend. Besteht ein Gleichmass zwischen rechts und links, deutet dies auf ein «In-der-Mitte-Stehen» hin. Zur Johanniszeit findet der Wechsel vom aufbauenden Teil des Jahres (durch Rechtsdrehung symbolisiert) zum abbauenden Teil des Jahres (durch Linksdrehung symbolisiert) statt. Das Johanniskraut blüht nicht zufällig in der Mitte des Jahres (auch andere Pflanzen blühen zu dieser Zeit), sondern weil dies zu seinem innersten Wesen gehört. Dann, wenn die Tage am längsten, die Lichtkräfte am intensivsten sind, entfaltet Hypericum seine sonnenhaften Blüten und scheint deren Lichtenergie wie mit Rädern (vergleiche Chakras) aufzunehmen. Die Überfülle an Lichtkräften kommt eindrücklich in den sehr zahlreichen Staubfäden und Staubbeuteln zum Ausdruck, die strahlenartig, wie Funken versprühend, von der Blütenscheibe ausgehen. Die harmonisch geformten ovalen und ungestielten Blätter erscheinen wie punktiert durchlöchert (daher der Namenszusatz perforatum). In Wirklichkeit sind dies die durchscheinenden Zellen von Exkretbehältern. Hier besteht ein direkter Bezug zwischen der Signatur und der spezifischen Wirkung des Johanniskrauts bei Stichverletzungen. Dies hat auch eine seelische Dimension, da Johanniskraut auch bei seelischen Verletzungen eingesetzt werden kann. Beim Zerdrücken der Blüten oder Knospen zwischen den Fingern tritt ein blutroter Farbstoff aus. Es handelt sich um die Substanzgruppe der Hypericine. Auch die Hypericum-Urtinktur oder das Johannisöl sind tiefrot. Rot ist die Farbe der Aktivität und der Willenskraft. Durch diesen reichlich enthaltenen Farbstoff bringt das Johanniskraut zum Ausdruck, dass die assimilierten Lichtkräfte zu Willenskraft transformiert werden können.»
Wesen
«Johanniskraut hat von allen Heilpflanzen die stärkste Beziehung zum Licht. Die zur Zeit der Sommersonnenwende blühende Pflanze fördert die Aufnahme und Speicherung von Licht und dessen Umwandlung in Nervenkraft. Licht ist eine essenzielle Energiequelle für die Nerven, die Schnittstelle zwischen Körper und Seele. Wer zu wenig aus dieser Quelle schöpfen kann, da – konstitutions- oder situationsbedingt – die Lichtaufnahmefähigkeit geschwächt ist oder das Lichtangebot durch anhaltend trübe Witterung oder langen Aufenthalt in künstlich beleuchteten Räumen vermindert ist, wird trübsinnig und depressiv. Dann wirkt Johanniskraut aufhellend. Johanniskraut ist auch bei Verletzungen von Körper und Seele angezeigt. Depressionen als Folge erlittener physischer und psychischer Verletzungen und Kränkungen oder Schnitt- und Stichwunden mit Nervenverletzungen werden sehr erfolgreich behandelt. Das Nervensystem wird stabilisiert. Dosierung beachten!»
Botanik
Hypericum perforatum L., das Johanniskraut, ist eine sommergrüne Staude, die in ganz Europa verbreitet ist und auf eher trockenen und sonnigen Standorten vorkommt. Die Art gehört zur Familie der Johanniskrautgewächse (Hypericaceae), wird bis etwa 80 cm hoch und wächst aus ihrer spindelförmigen Wurzel aufrecht nach oben. Der sehr harte, verholzende Stängel des Johanniskrautes ist durchgehend zweikantig, was man sehr gut fühlen kann, wenn man mit den Fingern an ihm entlangleitet. Im oberen Teil verzweigt sich der Stängel ästig und die Seitentriebe wachsen schräg aufwärts und bilden dadurch ein auf der Spitze stehendes Dreieck mit dem Stängel in der Mitte. An den Stängeln und Seitentrieben sitzen die gegenständigen und oval eiförmigen bis länglich linealischen Blätter der Pflanze. Sie sind dicht mit hellen und durchsichtigen Öldrüsen besetzt sind und geben den Blättern ein «perforiertes» Aussehen. Dies hat der Art ihren Beinahmen «perforatum» eingebracht hat. Im oberen Teil der Pflanze bilden sich im Juni, meist um Johanni herum, die Blüten der Pflanze aus. Diese sind fünfzählig, sie blühen gelb, und stehen in Trugdolden zusammen. Betrachtet man die gelben Kronblätter genauer, wird man auf diesen, dunkle Flecken von Drüsen erkennen. Ausserdem lässt sich erkennen, dass die Kronblätter je eine flache Seite sowie eine gewölbte Seite haben. Hierdurch sind sie leicht asymmetrisch und die Blüte erhält als Ganzes die Form eines Windrades verliehen. Um das Zentrum der Blüte herum, stehen in mehreren Bündeln viele Staubblätter, die wie Strahlen nach aussen greifen und der Blüten hierdurch ein sonnenhaftes Aussehen geben. Aus dem ganz in der Mitte stehenden Fruchtknoten entwickelt sich nach der Befruchtung eine Kapsel, die zahlreiche kleine Samen enthält. Beim Zerreiben der Blüte zwischen den Fingern hinterlässt das enthaltene Hypericin eine blutrote Färbung.
Verwendung
Das Johanniskraut, Hypericum perforatum L., zählt seit dem Altertum über das Mittelalter und bis heute zu den bekanntesten Heilpflanzen überhaupt. Aus den zahlreichen naturheilkundlichen Anwendungsgebieten, haben sich heute mehrheitlich diejenigen aus dem Bereich der Nerven, der Psyche, der Verdauung und Wundheilung durchgesetzt. Geistige Erschöpfungszustände, Verdauungsbeschwerden, Verletzungen des peripheren und zentralen Nervensystems und Verstimmungszustände gehören zu den heutigen Anwendungsgebieten. Diese basieren auf dem homöopathischen Arzneimittelbild und oder langjähriger traditioneller pflanzenheilkundlicher Anwendung. Des Weiteren wird Johanniskraut zur Wundheilung bei Entzündungen und Verbrennungen der Haut eingesetzt. Für die äusserliche Anwendung sind ölige Zubereitungen aus Johanniskraut üblich (Rotöl). Johanniskraut zählt heute zu den am besten untersuchten Arzneipflanzen mit belegter klinischer Wirksamkeit und guter Verträglichkeit.
Inhaltsstoffe
Charakteristische Inhaltsstoffgruppen des Johanniskrauts sind Naphthodianthrone (Hypericin), Phloroglucinderivate (Hyperforin) und Flavonoide (Hyperosid). Des Weiteren sind Procyanidine, ätherisches Öl und phenolische Säuren enthalten.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment report on Hypericum perforatum. EMA/HMPC/101303/2008 (2009).
- BGA/BfArM (Kommission E). Hyperici herba (Johanniskraut). Bundesanzeiger 228, (1984).
- BGA/BfArM (Kommission D). Hypericum perforatum (Hypericum). Bundesanzeiger 190 a, (1985).
- Linde, K., Berner, M. M. & Kriston, L. St John’s wort for major depression (Review). Cochrane Database Syst. Rev. (2008). doi:10.1002/14651858.CD000448.pub3
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2018).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil




KAMILLE
Matricaria chamomilla L.
WESEN: Geborgenheit, Geduld, Sanftmut, Mütterlichkeit
Wesen und Signatur
Signatur
«In den Kamillenblüten sehen wir das gleissende Licht des Hochsommers. Über dem trockenen, warmen Ackerboden haben die Lichtkräfte in ihr ihren Ausdruck gefunden. Der Blütenkranz ist blendend weiss, die aufgewölbte Blütenscheibe hellgelb glänzend. Die Blütenmitte fühlt sich fein an und hat eine glatte Oberfläche, so dass sie im Sonnenlicht einen starken Glanz ausstrahlt. Die Blätter sind sehr fein, zweifach fiederschnittig. Die einzelnen Abschnitte sind nur noch als Linien angedeutet. Wie Antennen oder wie feinfühlige Sinnesorgane richtet die Kamillenpflanze ihre Blattspitzen in alle Richtungen. Alles an ihr ist auf das Empfangen und Aufnehmen gerichtet. Eine hohe Sensibilität spricht aus ihrer Gestalt. Und doch ist die Kamille deswegen nicht hypernervös. Im Gegenteil, allerorts ist das dämpfende Prinzip, die Abfederung, am Werk. So sind die Blätter sehr weich, wie Federn. Am deutlichsten kommt das Prinzip der Dämpfung im gewölbten gelben Blütenboden zum Ausdruck. Im Verlaufe der Entwicklung wölbt er sich stark nachoben. In der Längsrichtung durchschnitten, gibt der zylindrische Blütenboden einen luftgefüllten Hohlraum frei. Wie durch ein Luftkissen dämpft die Blüte jegliche Heftigkeit ab. Das Blendende, Gleissende wird gemildert durch das sanft Dämpfende des luftgepolsterten Blütenbodens. Die Kamille hat ein tiefblaues ätherisches Öl, was eine Ausnahme ist; die ätherischen Öle sind meistens farblos oder gelblich. Doch das Öl ist nicht schon in der frischen Pflanze blau, sondern nimmt erst nach der Gewinnung durch die Wasserdampfdestillation diese Farbe an. Dabei wird ein blauer Stoff gebildet, der das Öl färbt. Das farblose, undifferenzierte ätherische Öl der Kamille wandelt sich in der Verbindung mit Wasser und Wärme zum Blauöl, das Sanftheit, Ruhe und mütterliche Geborgenheit ausstrahlt. Blau ist die Farbe des Ozeans, der Leben hervorbringt, und auch der Urmutter. Das farblose, undifferenzierte Wasser nimmt im strahlenden Sonnenlicht die tiefblaue Farbe des Ozeans an. Wesensverwandt sind die lateinischen Begriffe mare, mater und materia – und daran fügt sich die Matricaria, die Kamille, an. Der typische Geruch des Kamillenöls hat einen angenehm warmen, aber nicht feurigen Charakter. Die Kamille ist wohl der Inbegriff einer Heilpflanze. Ein von Bauchweh geplagtes Kind, die umsorgende Mutter, der warme Kamillentee – das gehört einfach zusammen. Es sind nicht nur die krampflösenden Wirkstoffe, die dem Kind so gut tun, das Kamillenwesen verstärkt zudem die mütterliche Zuwendung. Das Kind wird bei der Geburt aus der weichen, warmen, dunklen Geborgenheit des Mutterschosses hinausgestossen in eine harte, kalte und helle Welt. Das Neugeborene erfährt das Licht zuerst als einen blendenden Schmerz, doch nach und nach lernt es, sich am Licht zu orientieren, mit den Augen die Welt in sich aufzunehmen. Die Mutter umgibt das Kind mit der Weichheit und Wärme ihrer Geborgenheit, und sie begleitet es bei den ersten Entdeckungen im Licht der Welt, aber sie muss es immer wieder vor den extremen, gleissenden Sinneseindrücken behüten. Das Bedürfnis nach Wärme und Weichheit ist also geblieben, aber das Licht verliert langsam seine Bedrohlichkeit für den Säugling. Das Kind erwacht mehr und mehr im Verlangen nach dem weichen Schein des Lichts. Licht, Weichheit und Wärme begegnen uns in der wunderbaren Kamille.»
Wesen
«Kamille vermittelt ein Gefühl mütterlicher Geborgenheit, indem sie eine übersteigerte innere oder äußere Sinnesempfindlichkeit dämpft und Krampfzustände durch milde Wärme löst. Bei einer gesteigerten Sinnesempfindlichkeit erscheinen Mitmenschen, Situationen und Umwelt sowie der eigene Körper in einem grellen, übertriebenen Bild. Dann fühlt man sich angreifbar und ungeborgen, man ist sehr schmerzempfindlich, reizbar und reagiert bei geringstem Anlass ärgerlich und ungeduldig. In diesen Situationen vermittelt die Kamille eine ruhevolle Sanftheit und lindert entzündliche und krampfartige Prozesse.»
Botanik
Die Kamille (Matricaria chamomilla L.) (Familie: Asteraceae, Korbblütengewächse), wird zwischen 10 – 80 cm gross. An ihrem festen Stängel sitzen die sehr feinen und stark fiederschnittigen Blätter der Pflanze, die fast bis auf die Blattadern reduziert sind. Das Blatt hat dadurch praktisch keine flächige Struktur mehr. In den Monaten Mai bis August erscheinen die Blütenköpfchen einzeln an den Stängelenden, sie haben einen Durchmesser von 1.5 – 2.5 cm. Der Blütenstand ist aus weissen Zungenblüten und gelben Röhrenblüten zusammengesetzt. Der Blütenboden ist anfangs flach, später stark gewölbt mit einem Hohlraum der sich dann in der Mitte bildet. Die oberirdischen Pflanzenteile der Echten Kamille, insbesondere die Blüten, entwickeln beim Zerreiben einen angenehm aromatischen, charakteristischen Geruch. Ursprünglich war die Art vermutlich im Mittelmeergebiet heimisch, heute ist sie in Mitteleuropa verbreitet und kommt auf Äckern, Brachen und an Wegrändern vor.
Verwendung
Die in ganz Europa verbreitete Kamille besitzt ein sehr breitgefächertes Anwendungsspektrum, insbesondere im Bereich der Kinderheilkunde. Die Varianten der Zubereitungsformen sind vielfältig: Tee, Gewinnung des ätherischen Öls, Fluidextraktion mit wässrig-alkoholischen Lösungsmitteln und medizinisch-kosmetische Produkte. Die Kamille verfügt über antibakterielle und wundheilungsfördernde Eigenschaften. Deshalb hat sich das Spülen und Gurgeln des Mund-Rachenraumes mit Kamillenzubereitungen bewährt, um die entzündeten Schleimhäute zu beruhigen. Die entzündungshemmenden Eigenschaften in Kombination mit der krampflösenden Wirkungsweise erklären, warum Matricaria chamomilla L. zu den Hauptmitteln bei Reizungen, Krämpfen und Koliken der Verdauungsorgane zählt. Entzündungen der Atmungsorgane können ebenfalls mitbehandelt werden. In der Frauenheilkunde zählen krampfartige und schmerzhafte Beschwerden der weiblichen Geschlechtsorgane zu den Hauptanwendungsgebieten. Bei Kindern sind Kamillenpräparate bei reizbaren Verstimmungen, Unruhezuständen, Schlafstörungen und Zahnungsbeschwerden angezeigt.
Inhaltsstoffe
Matricaria chamomilla L. enthält ätherisches Öl, welches sich unter anderem aus Sesquiterpenlactonen (z.B. Matricin) zusammensetzt. Das während der Wasserdampfdestillation entstehende Chamazulen gibt dem Kamillenöl seine besondere tiefblaue Farbe. Weitere typische Inhaltsstoffe sind u.a. Flavonoide, Phenolcarbonsäuren und Cumarine.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). European Union herbal monograph on Matricaria recutita L., flos. EMA/HMPC/55843/2011 44, (2015).
- BGA/BfArM (Kommission D). Chamomilla Recutita (Chamomilla). Bundesanzeiger 217a, (1985).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.




KAPUZINERKRESSE
Tropaeolum majus L.
WESEN: Durchwärmung des Wässrigen und Lichtdurchdringung des Feuchten und Dunkeln
Wesen und Signatur
Signatur
«Die Kapuzinerkresse gehört zu den Pflanzen mit einer besonders ausdrucksstarken Signatur. Ihre Blätter sind eigentlich nicht diejenigen einer Landpflanze. Der Blattstiel ist mit der Mitte der Blattspreite verwachsen, so dass das beinahe kreisrunde Blatt wie ein Schild aussieht. Normalerweise ist der Blattstiel mit dem Grund der Blattspreite verwachsen, auch dann, wenn das Blatt sich ganz in die Runde ausbreitet, wie z. B. beim Frauenmantel. Das Konstruktionsprinzip dieses Blatts kommt sonst nur bei einigen Wasserpflanzen vor, deren Blätter auf dem Wasser schwimmen. Damit erkennen wir schon einen zentralen Aspekt der Signatur: Die Landpflanze Kapuzinerkresse bringt durch ihre Blätter den Charakter einer Wasserpflanze zum Ausdruck, und die Blattflächen markieren gewissermassen die Wasseroberfläche. Nun hat aber die Kapuzinerkresse äusserst licht- und wärmebetonte Blüten, wie man sie bei Wasserpflanzen nicht findet. Die grossen, schön geformten Blüten sind leuchtend gelb, strahlend orange und feurig rot. Viele andere Pflanzen bringen ebenfalls lichtbetonte Blüten hervor, die sich dann möglichst nach aussen hin orientieren, dem Licht zugewendet. Bei der Kapuzinerkresse finden wir umgekehrte Verhältnisse. Die strahlenden Blüten werden immer wieder von den Blättern überwachsen und ins Dunkel abgedrängt. Die Pflanze bildet zwar wieder neue Blüten, doch diese erleiden das gleiche Schicksal. So zeigt sich oft das erstaunliche Bild, dass die lichthaften Blüten, völlig verdeckt von den Blattschilden, im Dunkel vor sich hin leuchten. Da die Blattflächen wie oben dargelegt als «Wasseroberfläche» gesehen werden können, erkennt man darin das Wesen der Pflanze, das in der Lichtdurchdringung des Feuchten besteht.»
Wesen
grundlegenden Elemente des Lebens. Jede Lebensform gedeiht nur in einem spezifisch abgestimmten Verhältnis von Feuer und Wasser. Für die Landlebewesen gilt: Mangelt es an Wasser, vertrocknen die Lebensorganismen, gibt es Wasser im Überfluss, «ertrinken» sie. Das Feuer regelt diese Verhältnisse. Das Element Feuer ist von Natur aus warm und trocken, das Element Wasser nass und kalt. Das Maß des Eingreifens des Feuerelements (Sonne) schafft die den jeweiligen Lebensformen angepassten Verhältnisse von Warm und Kalt sowie Trocken und Nass. Diese Elemente haben auch eine höhere Bedeutung. Das Feuer steht für die Bewusstseins- oder Ich-Kraft, das Wasser für die Lebenskraft. Die Kapuzinerkresse wirkt als regelnde Kraft für die richtige, angemessene Verbindung des Feurigen mit dem Wässrigen. Sie «temperiert» das Wasser, durchdringt das Leben mit Bewusstseinskräften, bringt das Wärmeelement in Verbindung mit dem Kalten und Nassen und führt auf diese Weise zu einer Wiederbelebung von Bereichen in Körper und Bewusstsein, die aus dem Lebensprozess herausgefallen sind.
Der Kapuzinerkresse-Typ kann sich auf der Schattenseite des Lebens wähnen, der Platz an der Sonne ist immer schon besetzt. Er räumt anderen Menschen zu viel Macht ein. Er versteckt sich aber auch gerne hinter dem Rücken eines stärkeren Menschen, geht in seinem Windschatten durchs Leben. Darin steckt auch eine gewisse Feigheit, sich dem Leben zu stellen. Es fehlt ihm die konstante Wärme des gesunden Selbstbewusstseins. Dieser Menschentyp bewundert und beneidet insgeheim den Erfolg des Starken. Erfährt in seinem Kielwasser mit und identifiziert sich mit dem Erfolgreichen. Selbst traut er sich nicht zu, seine Ideen der Welt zu präsentieren, obwohl viel Kreativität in ihm steckt. In seinem innersten Wesen weiß er um seinen Wert, aber es fehlt ihm der Mut, die Charakterstärke, das Charisma, damit nach außen zu treten. Der geschilderte Menschentyp kann zu chronischen Infektionen (z.B. der Harnwege) neigen. Kapuzinerkresse unterstützt ihn in der Freisetzung von Wärmekräften.»
Botanik
Die Grosse Kapuzinerkresse, Tropaeolum majus L., ist in Mitteleuropa eine einjährige, nicht winterharte Pflanze. Sie stammt eigentlich aus den wärmeren Gebieten Südamerikas, ist aber heute in Mitteleuropa vielfach als Zier- oder Nutzpflanze verbreitet. Auffallend an ihr sind zunächst die grossen, leicht fleischigen Blätter. Deren charakteristische kreisrunde, schildartige Blattform entsteht dadurch, dass der Blattstiel in der Mitte der Blattspreite ansetzt und nicht unten am Blatt. Das Blatt selbst ist aufgrund seiner Struktur wasserabweisend, weshalb Regenwasser schnell abperlt. Die ganze Pflanze ist sehr «feucht» und hat einen sehr hohen Wassergehalt. Die Kapuzinerkresse überwächst mit ihren Ranken, die mehrere Meter lang werden können, rasch freien Boden und bedeckt diesen völlig. Ab etwa Juni bis in den Oktober hinein entstehen erst einzelne, dann aber immer mehr der leuchtenden, grossen gelb, rot oder orangefarbenen Blüten. Diese stehen oft unter den schildförmigen Blättern und werden dadurch von diesen bedeckt. Kostet man die Blätter oder auch die Blüten der Pflanze wird man feststellen, dass beide Teile ein sehr intensives, scharfes Aroma haben.
Verwendung
Die Kapuzinerkresse, Tropaeolum majus L., hat eine antimikrobielle Wirkung und wird zur unterstützenden Behandlung von Infektionen der ableitenden Harnwege und Katharren der oberen Luftwege eingesetzt. Das Lehrbuch der biologischen Heilmittel von Dr. med. Gerhard Madaus nennt chronische Bronchitis als das Hauptanwendungsgebiet. Die pharmakologischen Eigenschaften stützen sich dabei insbesondere auf die Wirkung der Benzylsenföle.
Inhaltsstoffe
Tropaeolum majus L. enthält Senfölglucoside. Der Zuckerteil der Senfölglucosiden kann durch die pflanzlichen Enzyme (Myrosinasen) abgespalten werden, wobei die typischen wasserdampfflüchtige stechend riechende und scharf schmeckende Isothiocyanate freigesetzt werden. Des Weiteren sind Polyphenole und Carotinoide enthalten.
Referenzen
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- BGA/BfArM (Kommission E). Tropaeolum majus (Kapuzinerkresse). Bundesanzeiger 162, (1992).
- Hänsel, R., Keller, K., Rimpler, H. & Schneider, G. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis Band 5 Drogen P-Z. (Springer Verlag Berlin Heidelberg, 1994).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.

KORIANDER
Coriandrum sativum L.
Botanik
Coriandrum sativum L., der Koriander, ist eine einjährige Pflanze, die bis zu 80 cm hoch wird. Der Koriander gehört zur Familie der Doldenblütler (Apiaceae). Zu dieser Pflanzenfamilie gehören vor allem viele duftende Heil- und Gewürzpflanzen. Von einem starken Duft, der nicht jedermanns Sache ist, ist auch der Koriander geprägt. Nach der Aussaat bildet die Pflanze erst Grundblätter, die aber rasch absterben. Sein aufstrebender, hohler, Stängel trägt dann gefiederte Laubblätter, beides kann sich während der Blütezeit manchmal rötlich verfärben.
Die Pflanzen blühen von Juni bis Juli und bilden langgestielte Blütendolden aus. Die Blüten wären relativ klein und unscheinbar, wären da nicht die grossen weissen oder rosafarbenen Blütenblätter der Randblüten. Diese sind stark vergrössert und heben so die Blüten deutlich über von dem Hintergrund aus Stängeln und Blättern ab. Koriander ist eine sehr beliebte Bienenweide.
Verwendung
Koriander wird bei dyspeptischen Beschwerden wie Appetitlosigkeit, Bauchkrämpfen, Blähungen und sonstigen Beschwerden des Verdauungstakts eingesetzt. Zudem ist der Koriander ein Bestandteil von Ausleitungskuren. Präparate aus Coriandrum sativum L. wurden eingesetzt um Schwermetalleinlagerungen aus dem Körper zu entfernen. Während klinische Studien zur Wirksamkeit von Koriander zur Schwermetallausleitung fehlen, gibt es aus wissenschaftlichen Arbeiten Hinweise, das Koriander Schwermetalle binden und deren Aufnahme, sowie auch deren toxischen Effekte reduzieren kann.
Inhaltsstoffe
In den Früchten des Korianders findet man ätherisches Öl. Des Weiteren findet man Phenolcarbonsäuren, Zucker, Proteine und fettes Öl. Charakteristische Bestandteile des ätherischen Öls sind das Tridecen-(2)-al, welches in der unreifen Pflanze einen grossen Teil des wanzenartigen Geruchs zu verantworten hat. Der Hauptbestandteil des ätherischen Öls in den Früchten ist hingegen das blumig riechende Linalool.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- Hänsel, R., Keller, K., Rimpler, H. & Schneider, G. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis Band 4 Drogen A-D. (Springer-Verlag, 1992).
- BGA/BfArM (Kommission E). Coriandri fructus (Koriander). Bundesanzeiger 173, (1986).4. Omura, Y. Significant Mercury Deposits in Internal Organs Following the Removal of Dental Amalgam, & Development of Pre-Cancer on the Gingiva and the Sides of the Tongue and Their Represented Organs as a Result of Inadvertent Exposure to Strong Curient Light (Used . Acupunct. Electro-Therapeutics Res., Int. J. 21, 133–160 (1996).
- Omura, Y. Role of Mercury (Hg) in Resistant Infections & Effective Treatment of Chlamydia Trachomatis and Herpes Family Viral Infections (and Potential Treatment for Cancer) by Removing Localized Hg Deposits with Chinese Parsley and Deliverung Effective Antibiotics. Acupunct. Electro-Therapeutics Res., Int. J. 20, 195–229 (1995).
- Aga, M. et al. Preventive effect of Coriandrum sativum (Chinese parsley) on aluminum deposition in ICR mice. J. Ethnopharmacol. 77, 203–208 (2001).
- Karunasagar, D., Balarama Krishna, M. V., Rao, S. V. & Arunachalam, J. Removal and preconcentration of inorganic and methyl mercury from aqueous media using a sorbent prepared from the plant Coriandrum sativum. J. Hazard. Mater. B 118, 133–139 (2005).
- Ren, H., Jia, H., Endo, H. & Hayashi, T. Cadmium detoxification effect of Chinese parsley coriandrum sativum in liver and kidney of rainbow trout oncorhynchus mykiss. Fish. Sci. 75, 731–741 (2009).
- Abascal, K. & Yarnell, E. Cilantro-culinary herb or miracle medicinal plant? Altern. Complement. Ther. 18, 259–264 (2012).
- Nishio, R., Tamano, H., Morioka, H., Takeuchi, A. & Takeda, A. Intake of Heated Leaf Extract of Coriandrum sativum Contributes to Resistance to Oxidative Stress via Decreases in Heavy Metal Concentrations in the Kidney. Plant Foods Hum. Nutr. 74, 204–209 (2019).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil

KÜCHENZWIEBEL
Allium cepa L.
Botanik
Die Küchenzwiebel, Allium cepa L., gehört zur Familie der Liliengewächse (Liliaceae). Sie ist eine mehrjährige Pflanze, die bis 120 cm hoch werden kann. Unter der Erde bildet die Pflanze eine bis 10 cm gross werdende, fleischige Zwiebel mit weissen, gelbbraunen oder toten trockenen Häuten aus. Aus der Zwiebel treibt ein röhriger Blütenschaft, der unterhalb der Mitte am dicksten ist. Die Blätter sind röhrig aufgeblasen und von blaugrüner Färbung. An der Spitze des Stängels bilden sich die grünlich-weissen Blüten die in einer kugeligen Dolde angeordnet sind. Der Blütenstand ist dicht mit Blüten besetzt und hat einen Durchmesser von bis 10 cm. Die Blüten schmücken die Pflanze ab Juni bis in den August hinein.
Verwendung
Zwiebeln werden als Lebens- und Arzneimittel genutzt. Die appetitanregende und reinigende Eigenschaft sowie die Anwendung der Zwiebel bei Augenleiden, Schwerhörigkeit und bei schlechtem Haarwuchs sind bereits in der altertümlichen Volksheilkunde bekannt. In der Phytotherapie gehören heute die Appetitlosigkeit und die Vorbeugung altersbedingter Gefässveränderungen zu den in der Fachliteratur beschriebenen Anwendungsgebieten. Homöopathisch wird die Zwiebel aufgrund der hervorgerufenen Leitsymptome bei Fliessschnupfen, Entzündungen der Atemwege, Blähungskoliken und Nervenschmerzen eingesetzt.
Inhaltsstoffe
Speziell für die Küchenzwiebel ist der verhältnismässig hohe Gehalt an freien Hydroxybenzoesäuren (hauptsächlich Protocatechusäure) in der braungelben Schale. Weitere typische Inhaltsstoffe sind schwefelhaltige Verbindungen wie das Alliin, ätherisches Öl und Flavonoide.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- Kommission E. Allii cepae bulbus ( Zwiebel ). Bundesanzeiger 50, (1986).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- BGA/BfArM (Kommission D). Allium cepa (Cepa). Bundesanzeiger 86, (1994).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment report on Allium cepa L., bulbus. EMA/HMPC/347195/2011 (2012).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil




LAVENDEL
Lavandula angustifolia MILL.
WESEN: Klärung, Reinigung, Transzendenz
Wesen und Signatur
Signatur
«Der Lavendel, eine mediterrane Bergpflanze, gehört zur Familie der Lippenblütler (Labiatae), aus der auch viele andere Duft- und Gewürzpflanzen stammen. Die weiten, blauvioletten Lavendelfelder in den Berggebieten der Provence besitzen eine magische Anziehungskraft. Hat sich hier ein Stück Himmel mit der Erde verbunden? In einem duftenden Lavendelfeld fühlen wir uns durchstrahlt von einer stillen, reinen Energie.
Der Blütenstand des Lavendels ist ganz aus der Sphäre der Blätter herausgehoben. Dicht aneinander gereiht umfassen die Blüten das Ende der aufrechten Zweige und entziehen – wenn viele Pflanzen zusammenstehen – die schmalen Blätter unserem Blickfeld. Dies führt dazu, dass kurz vor und zum Zeitpunkt der Blüte das Licht der Sonne nur noch abgeschwächt bis zur vegetativen Sphäre der Blätter hindurchdringen kann; die Pflanze ist ganz zur Blüte geworden und gibt sich der Luft des Himmels hin.
Wie sind nun die einzelnen Blütenquirle im Blütenstand angeordnet? Nachdem der Zweig die Blätter schon etwas überragt, beginnt sich der Blütenstand mit einem kleinen, den Stengel umfassenden Blütenquirl anzukündigen. Nach einem Abstand kommt ein zweiter Quirl, und nach einem weiteren, kürzeren Abstand tritt der volle Blütenstand in Erscheinung. Die Blütenwirkung kündigt sich stufenförmig an – in einer Art Blütenleiter mit sich verkürzenden Stufen. Haben Sie schon einmal Lavendelblüten aus der Apotheke genau betrachtet? Wer über botanische Grundkenntnisse verfügt, erkennt, dass es sich hierbei mehrheitlich um Blütenkelche handelt. Die ovalen Kelche haben die gleiche tiefe Farbe wie die Blüten, darum fällt die «Unstimmigkeit» nicht sofort auf. Es gehört zur Besonderheit des Lavendels, dass er kurz vor oder zu Beginn der Blütezeit geerntet wird und dass somit die Mehrheit der «Lavendelblüten» noch im Knospenstadium sind. Dies hat einen Grund: Entgegen der Regel, dass der Duft- und Wirkstoffgehalt von Blütendrogen zum Zeitpunkt der vollen Blüte am höchsten ist, finden wir bei der Lavendelblüte die grösste Heilkraft zu Beginn der Blüte. Der ovale Blütenkelch ist wie ein Gefäss. Die fünf Kelchblätter sind vollständig verwachsen, und vier der fünf Kelchblattzähne sind kaum mehr vorhanden. Der fünfte Kelchblattzahn ist jedoch erweitert und bildet eine herzförmige Lippe, die sich über die Öffnung des Kelchgefässes legt (mit Lupe erkennbar). Diese Lippe öffnet sich sofort, wenn die Blütenkrone aus dem Kelch hervordrängt. Eine wunderschöne Signatur: ein eiförmiger Kelch mit einem kleinen Deckelchen. In der Entwicklung des Lebens folgt auf das Keimen des Samens die Entfaltung und das Wachstum, dann die Blüte und die Fortpflanzung, später das Verblühen, die Fruchtreife und schliesslich das Verwelken und Absterben, um dann einem neuen Kreislauf Raum zu geben. Der Höhepunkt des natürlichen Lebens wird in der vollen Blüte gesehen. Aber erst wenn diese verblüht, kann sich daraus eine Frucht, ein Keim für neues Leben entwickeln. Der Lavendel hat seinen Höhepunkt nicht wie üblich zur Zeit der vollen Blüte, sondern etwas davor. Es scheint, als wolle der Lavendel noch auf eine andere Entwicklungsmöglichkeit als diejenige des natürlichen, biologischen Kreislaufs hinweisen. Eine seelische Höherentwicklung – soll sie zu echter Weisheit im Alter heranwachsen – muss zu einem Zeitpunkt beginnen, wo der Mensch noch über seine volle Vitalität verfügt. Transzendenz kommt auch in der Blütenfarbe Violett zum Ausdruck.»
Wesen
«Lavendel ist eine große »Seelenpflanze«, deren Bedeutung schon seit Jahrhunderten intuitiv verstanden wird. Dies bringt der botanische Name zum Ausdruck, der vom lateinischen lavare, waschen, stammt. Diese Reinigung ist aber nicht nur stofflich, sondern vor allem seelisch zu verstehen.
Lavendel wirkt klärend und beseelend. Er reinigt das Seelengefäß und bereitet Raum für subtilere und höhere Werte. Die Klärung bringt Ruhe und Nervenkraft. Dies erleichtert einerseits die Bejahung des persönlichen Schicksalswegs und fördert andererseits die Aufnahmebereitschaft für die Anforderungen der nächsten Stufe.
Lavendel hat die Kraft, den Menschen aufzurichten und die Seele zu öffnen. Er bringt seelische Klarheit, innere Ruhe und lenkt das Bewusstsein auf Lebensbereiche oder Beziehungen, die zu bereinigen sind, in denen Klarheit geschaffen werden soll. Menschen, die immer wieder seelische Krisen erleben, das heißt, in Kraft, Mut und Lebenswillen vorübergehend geschwächt werden, gibt Lavendel den Anstoß und die Möglichkeit, eine Hülle zu bilden. Die richtige Einschätzung seiner selbst und von anderen wird möglich. Lavendel hilft in Lebenskrisen und Übergangssituationen, als mütterliches Wesen nimmt er den Menschen liebevoll an die Hand und führt ihn über Hindernisse und durch Schwierigkeiten hindurch. Das Vertrauen in die umsichtige Führung ermöglicht es, in schwierigen Situationen zu bestehen und sich neuen Aufgaben und Herausforderungen zu öffnen.»
Botanik
Wer kennt ihn nicht, den Echten Lavendel, Lavandula angustifolia MILL.? Er gehört zur Familie der Lippenblütler (Lamiaceae) und stammt eigentlich aus dem Mediterrangebiet. Heute ist Lavendel jedoch in weiten Teilen Europas verbreitet, weil er vielerorts angepflanzt wurde. Der Lavendel ist ein aromatisch riechender Halbstrauch, der bis 60 cm hoch werden kann. Er bildet eine tiefgehende und starke Pfahlwurzel, die 3 bis 4 Meter in den Boden vordringen kann. Seine aufsteigenden und aufrechten Stängel sind vierkantig, wie es typisch für einen Lippenblütler ist. Sie verholzen im unteren Bereich, sind stark verästelt und reich beblättert. Die Blätter sind linealisch geformt, ganzrandig und am Rande leicht nach unten umgerollt. Blatt und Stängel weisen nur einen schwachen Geruch auf. Der intensive und so bekannte Lavendelduft entstammt den oberen Bereichen der Pflanze, aus dem Blühhorizont. Im Gegensatz zu anderen Mitgliedern der Familie sind die blauvioletten Blüten des Lavendels nicht in den Blattachseln angelegt, sie stehen stattdessen in Scheinähren zusammen. Diese erheben sich weit aus dem Blattbereich der Pflanze, erscheinen regelrecht getrennt von diesem. Lediglich ein einzelnes Hochblattpaar steht direkt unterhalb des Blütenstandes. Die Blüten stehen in einzelnen Wirteln an den Scheinähren zusammen, auffallend ist, dass der unterste Wirtel immer weit abgesetzt steht. Die Blüten haben einen intensiven aromatischen Geruch und bitteren Geschmack. Ihre 10 bis 12 mm lange Blumenkrone entfaltet sich mit der tief zweilappigen Oberlippe und einer weniger stark eingeschnittenen dreilappigen Unterlippe aus dem Kelch. Die Vollblüte dauert beim Lavendel nur wenige Tage, bereits nach kurzer Zeit zeigen sich erste verblühte Blüten. Für Bienen stellt der Lavendel eine sehr gute Nährpflanze dar, er wird daher zur Blütezeit intensiv von ihnen besucht. Das Öl, welches in der Parfümerie intensiv eingesetzt wird, stammt im Übrigen nicht aus der Blüte, sondern aus den Drüsenhaaren des Kelches.
Verwendung
Die Lavendelblüten, Lavandulae Flos, wurden schon von Paracelsus als bewährtes nervenstärkendes Mittel genannt. Die Verwendung des reinen ätherischen Öls von Lavandula angustifolia MILL. ist in der Kosmetik und der therapeutischen Praxis gleichermassen weit verbreitet. Wenn wir an die beruhigende Duftwirkung der Lavendelkissen denken, verwundert es nicht, dass Ein- und Durchschlafstörungen zu den wichtigsten Indikationsgebieten gehören. Als mild wirkendes Sedativum helfen arzneiliche Zubereitungen des Lavendels, die Unruhe des Tages zu überwinden. Neben Schlafstörungen sind pflanzenheilkundlich funktionelle Oberbauchbeschwerden als weiteres Anwendungsgebiet bekannt. Insbesondere, wenn es sich um nervös bedingte Störungen handelt, wie zum Beispiel Reizmagen und Reizdarm. In Kombination mit anderen Heilpflanzen ist aufgrund der entblähenden Wirkung von Lavendel auch ein Einsatz bei Meteorismus möglich. Somit ist Lavendel von der Anwendung ähnlich wie die Melisse ein geeignetes Magen- und Nervenmittel.
Inhaltsstoffe
Die Aromapflanze, Lavandula angustifolia MILL., ist reich an ätherischem Öl. Die Hauptbestandteile des ätherischen Öls sind: Linalylacetat, Linalool, Cineol und Campher. Des Weiteren findet man Cumarine und die für diese Pflanzenfamilie typischen Lamiaceengerbstoffe.
Referenzen
- Wichtl M, Czygan F-C, Frohne D, et al. Teedrogen Und Phytopharmaka. 3rd ed. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland; 1997.
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment report on Lavandula angustifolia Miller , aetheroleum and Lavandula angustifolia Miller , flos. EMA/HMPC/143183/2010. EMA/HMPC/143183/2010. Published online 2012.
- Madaus G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. Nachdruck. mediamed Verlag, Ravensburg; 1990.
- BGA/BfArM (Kommission E). Lavandulae flos ( Lavendelblüten ). Bundesanzeiger. 1984;228.
- Kalbermatten R, Kalbermatten H. Pflanzliche Urtinkturen. 9th ed. AT Verlag, Aarau, Schweiz; 2018.
- Kalbermatten R. Wesen Und Signatur Der Heilpflanzen. 9th ed. AT Verlag, Aarau, Schweiz; 2016.
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.




LÖWENZAHN
Taraxacum officinale L.
WESEN: Wandlung, Anpassungsfähigkeit, Fluss der Lebensenergie, Wärme, Lebenskraft
Wesen und Signatur
Signatur
«Der Löwenzahn kündigt mit grosser Kraft den Frühling an: Die Wiesen sind noch winterkalt und nass. Am Himmel zieht die Sonne wieder höhere Bahnen und berührt die Natur mit den ersten wärmenden Strahlen. Das neue Jahr erwacht. Nun erblüht der Löwenzahn in grosser Zahl, färbt ganze Wiesen gelb mit Tausenden auf die Erde gesunkenen kleinen Sonnen. Eine Zeit lang können wir uns an diesen Frühlingsboten erfreuen, doch bald schon verwandeln sich die Sonnenblüten in die silberhellen, durchlüfteten Kugeln der Fruchtstände. Ist der Zeitpunkt der Samenreife gekommen, werden die kleinen Fallschirmchen mit dem ersten Wind in die Weite getragen. Die gelben Blüten sind wie Spiegel der Sonne; verschwindet sie hinter den Wolken, schliessen sie sich. Regnet es, sind die Blüten manchmal so stark geschlossen, dass nicht mehr erkennbar ist, ob sie nicht schon verblüht sind.
Die ganze Pflanze ist weich, der Stengel hohl, röhrenartig, von reichlich strömendem weissem Milchsaft durchflossen. Alle Pflanzenteile enthalten diesen Milchsaft, der – wenn Kinder mit den Stengeln spielen und Wasserleitungen bauen – auf den Kleidern schwarze, nicht mehr auswaschbare Flecken hinterlässt. Die Blätter sind vielgestaltig gezähnt (daher der Name); keine zwei Blätter könnten in ihrer Form zur Deckung gebracht werden. Der Geruch ist schwach, kaum wahrnehmbar, aber der Geschmack aller Pflanzenteile ist bitter. In diesem bitteren Geschmack finden wir die Beziehung des Löwenzahns zur Leber und zur Galle, da bittere Stoffe den Gallenfluss und die Leberfunktionen anregen.
Der Löwenzahn steht mit seinem ganzen Wesen völlig im Gegensatz zu jeglicher Erstarrung und Fixierung auf feste Formen und Stabilität. Er ist ganz auf Veränderung ausgerichtet. In seinem Wandel der Formen ist er ein Spiegelbild für die sich ständig im Fluss befindlichen Stoffwechselprozesse der Leber.»
Wesen
«Der Löwenzahn gehört zu den anpassungsfähigsten und vitalsten Pflanzen. Die durch den Löwenzahn vermittelte Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit bezieht sich gleichermaßen auf Ideen, Wertvorstellungen und Anschauungen wie auf die Stoffwechselaktivität der Leber. Beide Ebenen weisen einen engen Zusammenhang auf: Wie die Leber eine rege Umwandlungsaktivität von chemischen Substanzen entfaltet, so erfährt die innere Anschauung im Verlauf des Lebens immer wieder Anpassungen, Änderungen und Erweiterungen. Vorstellungen müssen an der Lebenserfahrung überprüft und eventuell angepasst oder korrigiert werden. Doch bereitet kein anderer Prozess auf der seelisch-geistigen Ebene so viel Mühe wie die Änderung von einmal gebildeten Werten und Anschauungen. Zwar weichen Vorstellung und Realität aufgrund der Unvollkommenheit des Bewusstseins immer mehr oder weniger voneinander ab; wird jedoch ein bestimmtes Maß der Abweichung überschritten, so führt dies zu Ärger oder Bitterkeit. Damit ist in der Regel auch eine Störung der Leberfunktion und des Gallenflusses verbunden. Löwenzahn dynamisiert die Wandlungs- und Anpassungsprozesse, löst Stauungen und Erstarrungen in Geist und Körper und vermittelt dadurch neue Lebenskraft.»
Botanik
Wer kennt ihn nicht, den Löwenzahn? Fast überall begegnet er uns. Der Löwenzahn gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae). Er ist auf nährstoffreichen Wiesen, auf Äckern und Gärten zuhause und dringt sogar bis in die Städte vor. Er bevorzugt überdüngte Standorte mit einem hohen Stickstoffanteil in den Böden. Mit seiner Pfahlwurzel dringt er bis 2 m tief in den Boden vor und kann oberirdisch bis über 40 cm hoch werden. Seine Wurzel ist sehr vital und kann sich, selbst aus kleinen Bruchstücken, regenerieren und wieder zu einer neuen Pflanze wachsen. Die Blätter stehen in einer grundständigen Blattrosette zusammen. Sie sind verkehrteiförmig bis eilanzettlich und lebhaft grasgrün. Zudem sind sie äusserst vielgestaltig geformt und unterschiedlich stark fiederlappig. Vergleicht man die Blätter verschiedener Exemplare, so wird man keine zwei finden, deren Form identisch ist. Die ganze Gattung Taraxacum ist sehr vielgestaltig und wandlungsfähig und dadurch sehr schwer zu bestimmen. Zeitig im Frühjahr, spätestens im April, beginnt der Löwenzahn mit der Blüte. Die grossen, sonnenhaften gelben Blütenköpfe, zusammengesetzt aus bis zu 200 einzelnen Zungenblüten, gehen aber nur bei sonnigem Wetter auf. Bei Regen oder stark bedecktem Himmel bleiben sie geschlossen. Sie stehen einzeln auf Stängeln, die, gleich einer Röhre, hohl sind. Die Entwicklung von der Knospe über die Blüte bis hin zur «Pusteblume» geht rasch vonstatten, schon kurz nach dem Aufblühen der ersten Blüten finden sich bereits erste «Pusteblumen», die ihre Samen auf die Reise schicken. Selbst nach dem Verblühen bleibt uns die vitale Rosette erhalten, und die Pflanze treibt aus ihr im folgenden Jahr die nächsten Blüten. Löwenzahnblätter sind auch im Salat schmackhaft, er schmeckt bitter und ist in allen Teilen erfüllt von einem weissen, kautschukhaltigen, Milchsaft. Bekommt man diesen Saft auf die Kleidung so zeigt sich die Begegnung nach dem Waschen in den typischen braunen und schwarzen Flecken…
Verwendung
Der Löwenzahn zählt zu den bekanntesten und meist verwendeten Heil- und Lebensmittelpflanzen der mitteleuropäischen Flora. Er wird traditionell in Frühjahrskuren zur Anregung des Stoffwechsels und zur Reinigung des Blutes angewendet. Das Spektrum der Darreichungsformen ist sehr breit und reicht von Frischpflanzensäften, Teeinfusen, Fluid- und Trockenextrakten bis hin zu alkoholischen Tinkturen. Zielorgan der Wirkung von Zubereitungen aus Taraxacum officinale L. in verschiedenen Therapierichtungen ist das Leber-Galle-System. Die Wiederherstellung der Leber- und Gallenfunktion steht dabei im Mittelpunkt. Störungen des Leber-Galle Systems stehen oft mit Müdigkeit, Schwäche, Hautleiden, Juckreiz, Verdauungs- und Oberbauchbeschwerden im Zusammenhang. Da durch den Löwenzahn insbesondere auch der Fluss der Gallensäfte angeregt wird, hat Löwenzahn insgesamt einen sehr förderlichen Einfluss auf den gesamten Gastrointestinaltrakt. Appetitlosigkeit, dyspetische Beschwerden wie Völlegefühl und Blähungen können mit Löwenzahn mitbehandelt werden. Die Anwendungsgebiete des Löwenzahns reichen pflanzenheilkundlich bis in den Urogenitaltrakt hinein. Durch die Anregung der Diurese kann diese Heilpflanze auch zur Durchspülung der Harnwege und der Begleitbehandlung von leichten Harnwegsbeschwerden genutzt werden. Weitere volkstümliche Anwendungsgebiete des Löwenzahns sind mitunter Stauungen im Pfortadersystem, Gicht und rheumatische Erkrankungen und Ekzeme.
Inhaltsstoffe
Typische Inhaltsstoffe des Löwenzahns, Taraxacum officinale L., sind Bitterstoffe und Mineralstoffe wie zum Beispiel Kaliumsalze. Zu den weiteren Inhaltsstoffgruppen gehören: Sesquiterpenlactone, Triterpene und phenolische Verbindungen. Variierend mit der Jahreszeit sind im Löwenzahn, insbesondere der Wurzel, nennenswerte Mengen an Kohlenhydraten (Inulin und Fructose) enthalten.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- BGA/BfArM (Kommission E). Taraxaci radix cum herba (Löwenzahnwurzel mit -kraut). Bundesanzeiger 228, (1984).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). COMMUNITY HERBAL MONOGRAPH ON TARAXACUM OFFICINALE WEBER ex WIGG., RADIX CUM HERBA. EMA/HMPC/2128895/2008 Corr (2019).
- BGA/BfArM (Kommission D). Taraxacum officinale (Taraxacum). Bundesanzeiger 66a, (1989).
- Hänsel, R., Keller, K., Rimpler, H. & Schneider, G. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis Band 5 Drogen P-Z. (Springer Verlag Berlin Heidelberg, 1994).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.




MAIGLÖCKCHEN
Convallaria majalis L.
Botanik
Wohl jeder kennt das Gewöhnliche Maiglöckchen, Convallaria majalis L. Das kleine Pflänzchen erfreut uns im Frühjahr mit seinen schönen Blütenständen, die den typischen, intensiv aromatischen Duft verströmen. Die Pflanze ist in Europa bis Nordostasien sowie in Nord-Amerika verbreitet und wächst auf gut mit Humus versorgten Böden in wärmerer Lage. Der Wurzelstock der Pflanze verzweigt sich gerne, weshalb die Maiglöckchen oft in grossen Trupps anzutreffen sind. Nach dem zweiten Winter treiben aus den unterirdischen Teilen lang gestielte und breit lanzettliche bis 10 cm lange Blätter mit einer parallelen Nervatur aus. Der Stängel ist unbeblättert und trägt die, von Mai bis Juni blühenden und stark duftenden, weissen Blüten. Diese stehen zu 3 bis 10 blütigen einseitswendigen Trauben zusammen und weisen ein glockiges Erscheinungsbild auf. Ihre Blütenhülle ist verwachsen, die Blüten hängen herab. Nach der Befruchtung entwickeln sich mehrsamige rote Beeren. Alle Teile des Maiglöckchens sind stark giftig, besonders die Blüten und Beeren. Jedes Jahr gibt es Fälle durch Tod von Maiglöckchenverzehr, da die Pflanze oft am selben Standort wie der Bärlauch gefunden werden kann. Im blütenlosen Zustand können diese beide Arten leicht verwechselt werden. Der Bärlauch hat aber, als leicht erkennbares Unterscheidungsmerkmal, keinen langen, runden Blattstiel und riecht intensiv nach Knoblauch.
Verwendung
Wie die Herbstzeitlose gehört auch das Maiglöckchen zu den bekannten Giftpflanzen und es besteht auch hier Verwechslungsgefahr mit dem Bärlauch. Die Toxizität beruht auf den herzwirksamen Steroidglykosiden. Die therapeutisch wirksame Dosis, welche die Schlagkraft des Herzens erhöhen kann, liegt jedoch nahe an der toxischen Dosis, welche zu Übelkeit, Herzrhythmusstörungen und Tod führen kann. Aufgrund des Gehalts an positiv inotrop wirkenden Steroidglykosiden wurde Maiglöckchen (Pulver) früher bei leichter Herzinsuffizienz (Belastungsinsuffizienz, Altersherz) eingesetzt. Heute werden gemäss den Leitlinien höchstens noch die im Fingerhut (Digitalis) vorkommenden Steroide bei der Herzinsuffizienz eingesetzt. Auch in der Homöopathie wird Convallaria den Leitsymptomen entsprechend bei Herzrhythmusstörungen und Herzschwäche eingesetzt. Dies jedoch nur in potenzierter Form, sodass Vergiftungserscheinungen ausgeschlossen werden können.
Inhaltsstoffe
Maiglöckchenkraut enthält herzwirksame Steroide (Cardenolidglykoside), Saponine, Falvonoide und Pflanzensäuren.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- BGA/BfArM (Kommission E). Convallariae herba ( Maiglöckchenkraut ). Bundesanzeiger 76, (1987).
- BGA/BfArM (Kommission D). Convallaria majalis. Bundesanzeiger 16, (1989).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.




MARIENDISTEL
Silybum marianum (L.) GAERTN.
WESEN: Abgrenzung, Schutz, Individualität
Wesen und Signatur
Signatur
«Die Mariendistel bevorzugt warme, trockene Standorte; sie stammt aus dem Mittelmeergebiet, wo sie weit verbreitet ist. In Mitteleuropa wird sie gelegentlich angebaut. Die Mariendistel ist eine starke Pflanzenpersönlichkeit. Mit ihrer stattlichen Größe und den äußerst wehrhaften Stacheln verschafft sie sich Respekt und hält Mensch und Tier in sicherem Abstand. Mit ihren charakteristischen zweifarbigen, zähen Blättern trägt sie den Stempel betonter Individualität: Sie kann nicht übersehen oder verwechselt werden. Wer einmal eine Mariendistel gesehen hat, vergisst sie nicht wieder. Die Signatur der Mariendistel bringt das Wesen von Schutz, Abgrenzung und Individualität deutlich sichtbar zum Ausdruck. Wie viele andere Distelarten ist sie an den Blütenkörben und den Blättern mit Stachelspitzen bewehrt. Die Abwehrfunktion ist so vollendet wie bei kaum einer anderen Distel. Schon bei einer leichten Berührung dringen die Stacheln in die Haut. Sie sind so scharf, hart und lang, dass man sich der Pflanze nur mit äußerster Vorsicht nähern kann. Bei der Ernte der reifen Blütenköpfchen bekommt man diese Wehrhaftigkeit trotz Schutzkleidung oft schmerzhaft zu spüren. Die Blätter sind sehr fest, glänzend und wirken dauerhaft wie die Blätter oder Nadeln winterharter Gewächse. Die charakteristische Färbung der Blätter ist das sicherste Erkennungszeichen der Mariendistel. Das satte Grün wird entlang der Blattnerven von einem Netzwerk breiter, weißer Streifen überzogen, die die Blattnerven markieren. So liegt das eigentliche Blattgrün wie Inseln verteilt in diesem weißen Bändernetz. Man erkennt also in den Blättern farblich klar voneinander abgegrenzte Zonen. Der Blattrand ist nach innen gebuchtet und weit über die Blattebene hinaus aufgeworfen, so dass der Blattumfang, die Blattgrenze deutlich vergrößert und betont wird. Eine sanftere Form der Abwehr und des Schutzes finden wir im Inneren der Blütenköpfchen. Die purpurnen, leicht klebrigen Röhrenblüten machen nach dem Verblühen eine überraschende Veränderung durch. Die Farbe wandelt sich von Purpur über Blau zu Grau. Gleichzeitig legen sich die kleinen, röhrenförmigen Blütenblätter – ausgehend von der Mitte der Köpfchen – radial nach außen um und verkleben miteinander. Auf diese Weise bilden sie als Schutz für die reifenden Früchte ein regendichtes Dach, das wie ein perfektes, kegelförmiges Strohdach aussieht.»
Wesen
«Die Mariendistel fördert die Fähigkeit, sich gegenüber emotionaler und physischer Ausbeutung, gegen über Angriffen und Manipulationen angemessen zu behaupten. Sie unterstützt die Wahrung der eigenen Persönlichkeit, indem sie die aktive Abgrenzung gegenüber schädigenden psychischen Einflüssen stärkt. Zu beachten ist, dass sich eine psychische Abwehrschwäche auf gegensätzliche Arten äußern kann, entweder in der Unfähigkeit zur Abgrenzung und zum Neinsagen oder aber in einer übersteigerten, aggressiven Abgrenzung. Eine solche Schwäche kann zu einer Störung der Entgiftungs- und Ausscheidungsfunktionen der Leber führen und damit Ursache von chronischen Krankheiten sein.»
Botanik
Die Mariendistel, mit botanischem Namen Silybum marianum (L.) GAERTN., gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae). Es handelt sich bei ihr um eine einjährige, selten zweijährige Pflanze die eine imposante Pflanzengestalt von bis zu 2.50 m Grösse entwickeln kann. Sie bildet nach der Keimung zunächst eine Pfahlwurzel und eine dem Boden aufliegende Rosette aus. Aus dieser Rosette entsteht dann ein kräftiger aufrechter Stängel, der sich etwa ab der Mitte verzweigt. Am Stängel stehen die länglich-elliptischen, buchtig fiederteiligen Blätter. Alle Blätter der Pflanze weisen mehrere Besonderheiten auf: Zunächst sind sie nicht rein grün, wie man es von pflanzlichen Blättern sonst kennt, sie weisen Bereiche auf, in denen das Chlorophyll fehlt und die dadurch weiss «gefärbt» sind. Ausserdem sind die Blätter nicht flach, wie es typisch wäre, sie sind stattdessen dreidimensional aufgewölbt und zeigen dadurch einen welligen Blattrand. Vor allem der Blattrand ist mit gelblichen Stacheln bewehrt, die sehr lang und spitz sind. Eine unachtsame Begegnung mit der Mariendistel vergisst man nicht so schnell! An den Spitzen der Stängel sitzen die purpurfarbenen, 4 bis 6 cm grossen, eiförmigen Blütenköpfe, die nur aus Röhrenblüten zusammengesetzt sind. Auch die Blütenstände, welche von Juli bis August blühen, sind mit den scharfen Stacheln bewehrt. Nach dem Verblühen, wenn die Samen der Pflanze mit der Ausreifung beginnen, klappen die Röhrenblüten um, verkleben und bilden ein Dach über den Samen, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwendung
Die Mariendistel ist als eines der Hauptmittel bei Erkrankungen der Leber und Gallenwege bekannt. Zu den typischen Anwendungsgebieten gehören dyspeptische Beschwerden und toxische Leberschäden. Leberbedingte Kopfschmerzen, Übelkeit, Verdauungsstörungen und Varizen zählen aus naturheilkundlicher Sicht zu den bewährten Anwendungsgebieten. Die Mariendistel wird auch homöopathisch bei Leber-Galle Erkrankungen eingesetzt. Darüber hinaus wird die Mariendistel gemäß homöopathischem Arzneibild bei Hämorrhoiden und Krampfaderleiden, sowie bei Rheumatismus der Schulter und der Hüfte angewendet. Pflanzenheilkundliche Zubereitungen aus Mariendistelfrüchten werden unterstützend bei chronisch-entzündlichen Lebererkrankungen und Leberzirrhose eingesetzt. Silybum marianum (L.) GAERTN. gehört zu den besonders gut erforschten Heilpflanzen. Der schützende Effekt auf die Leberzellen wird durch folgende drei Eigenschaften erklärt: Stabilisierung der Leberzellmembran, Radikalfänger- und Antioxidansfunktion und Beschleunigung der Leberzellregeneration. So liegt in der Mariendistel das Potential einer Belastung mit leberschädigenden Substanzen entgegenzuwirken. Diese Eigenschaft macht man sich bei der Anwendung von Silibinin bei Knollenblätterpilzvergiftungen zu Nutze.
Inhaltsstoffe
Charakteristisch für die Mariendistel ist ihr Gehalt an Lignanen. Darunter ist Silymarin – ein Stoffgemisch aus Silibininisomeren und -derivaten – am bekanntesten und am besten erforscht. Weitere Flavonoide, wie Quercetin sind ebenfalls enthalten. Darüber hinaus sind die Samen bzw. Früchte der Mariendistel auch reich an fetten Ölen.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment report on Silybum marianum (L.) Gaertn., fructus. European Medicines Agency (2018).
- BGA/BfArM (Kommission E). Cardui mariae fructus ( Mariendistelfrüchte ). Bundesanzeiger 50, (1986).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). European Union herbal monograph on Silybum marianum (L.) Gaertn., fructus Final. (2018).
- BGA/BfArM (Kommission D). Silybum marianum (Carduus marianus). Bundesanzeiger 129 a, (1985).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.




MEISTERWURZ
Peucedanum ostruthium (L.)
WESEN: Selbstbewusstsein, Befreiung aus Einengung und Zwang
Wesen und Signatur
Signatur
«Auf einer Darstellung von Paracelsus sehen wir den grossen Arzt und Universalphilosophen des 16. Jahrhunderts mit einer Meisterwurzwurzel in der Hand. Es heisst, dass er immer eine solche Wurzel bei sich getragen habe. Für Paracelsus war die Meisterwurz eine der ganz grossen Heilpflanzen, und sie hatte damals und noch lange danach generell eine universelle Bedeutung.
Der oberflächliche erste Eindruck ist eher ernüchternd. Wenn wir der Meisterwurz im Sommer in den Bergen begegnen, fallen uns an ihr keine besonderen Farben oder Formen auf. Dies erklärt sich aus ihrer botanischen Zugehörigkeit. Die Pflanze gehört zur Familie der Doldengewächse (Umbelliferae) mit ihren zahlreichen Vertretern, die für den Laien oft nur schwierig zu unterscheiden sind. Allen Arten dieser Familie ist der schirmförmige, meist weisse Blütenstand (z. B. Wiesenkerbel) gemeinsam. Es ist eine Pflanzenfamilie, die keine spektakulären äusseren Erscheinungen hervorbringt. Dennoch gehören zu ihr einige bedeutende Gewürz-, Heil-, und Giftpflanzen ebenso wie aromatische Nahrungspflanzen (Petersilie, Kümmel, Fenchel, Anis, Sellerie, Schierling usw.). Da die Blüten, wie gesagt, keine bemerkenswerten Kennzeichen tragen, muss man das Wesen der Doldengewächse vor allem an den Blättern verstehen lernen. Suchen wir dazu die Meisterwurz an ihrem natürlichen Standort auf. Wir finden diese typische Bergpflanze an nährstoffreichen, feuchten und oft steinigen Plätzen. Die Meisterwurz erkennen wir schnell am Glanz ihrer Blätter. Dieser ist nicht etwa besonders stark und auffällig, er ist edel und vermittelt den Eindruck von Kompaktheit. Die Blätter strahlen mit ihrem eigenen Glanz eine kraftvolle Selbstverständlichkeit aus. Auch viele andere Pflanzenkenner waren vom ersten Moment an vom Glanz dieser Blätter fasziniert und spürten die Kraft, die davon ausgeht.
Wenn man diese Pflanze intuitiv ergründet, erkennt man eine Kraftwirkung, die am besten mit «nach oben ausweitend» umschrieben werden kann. Es ist eine Wirksamkeit, die einen deutlichen Bezug zum Brustkorb aufweist. Die Kräfte der Meisterwurz scheinen – auf der energetischen Ebene – den Brustkorb auszuweiten und gleichzeitig zu straffen. Früher gebrauchte man für eine Haltung, die Selbstbewusstsein zum Ausdruck bringt, die Formulierung «mit geschwellter Brust». Die analoge Form finden wir auch in den Blättern. Sie sind dreizählig mit drei gestielten Teilblättern. Die Teilblätter sind aufgerichtet und erinnern an eine nach oben halb geöffnete Hand, sie sind tief dreiteilig gespalten. Die einzelnen Teile (die gespaltenen) haben die für die Meisterwurz wesenseigene, nach oben ausgeweitete Form. Auch wenn man die Pflanze als Ganzes oder den Blütenstand kurz vor dem Aufblühen betrachtet, findet man immer wieder als charakteristisches Merkmal die Ausweitung nach oben.
Folgende Begebenheit illustriert die grosse Macht dieser Pflanze. Unser Heilpflanzensammler, der die Wirkungen der Heil- und Giftpflanzen wie jeder echte Pflanzenkenner durch eigenes Probieren untersucht, hatte sich einmal beim Testen einer sehr giftigen Bergpflanze in der Dosierung stark verschätzt. Er ass ein Stück einer Wurzel von Cyclamen europaea und erlitt nach kurzer Zeit eine dramatische Wirkung; die Luftröhre begann rasch anzuschwellen und sich zu verengen, und die Atmung wurde bedrohlich erschwert. In höchster Not erinnerte er sich an die alten Berichte über die fantastischen Wirkungen der hoch geschätzten Meisterwurz. Im letzten Moment, schon dem Ersticken nahe, fand er eine Meisterwurz, grub die Wurzel aus und träufelte sich deren Saft in die Kehle. Bereits nach 1 Minute begann sich die Luftröhre zu weiten, und nach 10 Minuten hatte die Giftwirkung vollständig nachgelassen, und er konnte wieder frei atmen.
Solche Ereignisse, die auch in der heutigen Zeit noch geschehen können, lassen erahnen, warum die Meisterwurz früher eine so grosse Bedeutung hatte.
Wir erkennen an der Signatur der Meisterwurz die Kennzeichen von Macht und Selbstbewusstsein, die es nicht nötig haben, durch auffällige äussere Zeichen zu beeindrucken. Echte Kraft wirkt als Selbstverständlichkeit von innen. Eine solche innere Kraft ist der beste Garant für die Abwehr von schädlichen äusseren Einflüssen wie Giftwirkungen auf der körperlichen oder seelischen Ebene.»
Wesen
«Die Meisterwurz hat ein wahrhaft königliches Wesen. Sie symbolisiert ein Selbstbewusstsein, das andere nicht übergeht und auch im Mitmenschen die guten Eigenschaften hervorholen kann. Die innere Gewissheit ihrer Existenzberechtigung lässt sie anderen Menschen gegenüber wohlwollend und fördernd auftreten. Eine Aura von Glanz und Selbstverständlichkeit umgibt sie, bedrohliche Einflüsse prallen an ihr ab.
Menschen, die aus Mangel an innerer Sicherheit leicht angreifbar sind, die dazu neigen, sich allerlei schädigenden Einflüssen zu öffnen, können sich mit Hilfe dieses Pflanzenwesens ihrer Situation bewusst werden. Imperatoria stärkt die innere Kraft: Ein Kraftstrom erfasst die Mitte des Menschen, steigt vom Magen auf, erweitert den Brustraum und richtet die Schultern auf. Imperatoria ist auch ein äußerst potentes Antidot gegen verschiedenste Giftwirkungen auf Körper und Seele.»
Botanik
Peucedanum ostruthium (L.) Koch, so der lateinische Name der Meisterwurz, hat ihren Namen «Imperatoria» also die Kaiserliche, aufgrund ihrer hohen Heilkraft erhalten. Die Pflanze gehört zur Familie der Doldenblütler (Apiaceae). Sie wächst in bergiger Lage auf feuchten Bergwiesen, Staudenfluren und an Bächen. Ihre quergeringelten, braunen Rhizome sind 2-3 cm dick und werden bis 10 cm lang. An diesen entstehen zahlreiche Seitentriebe und Ausläufer. Aus den unterirdischen Teilen bilden sich Stängel, die nur wenige, nach oben aufgerichtete, Laubblätter tragen. Diese sind 3zählig und weisen gestielte Teilblätter auf. Am Rand sind sie grob und unregelmässig gezähnt. Ab Juli blüht die Meisterwurz mit weissen oder rötlichen Blüten die zu 30-60 strahligen Dolden an den Enden der Stängel oder langen Stielen in den Blattachseln stehen. Die ganze Pflanze, vor allem die unterirdischen Teile, sind durch einen aromatisch würzigen Duft ausgezeichnet.
Verwendung
Die Meisterwurz, Imperatoria, findet in den medizinisch-botanischen Klassikern des Mittelalters eine sehr häufige Nennung: u.a. in den Werken von Paracelsus, Lonicerus und Hieronymus Bock. Die in den alten Kräuterbüchern gesammelten Angaben bilden vielfach den Ausgangspunkt für das bis in die heutige Zeit hinein überlieferte Heilpflanzenwissen. Bei einigen Arzneipflanzen wurden die traditionellen Angaben durch aktuelle, wissenschaftliche Forschungen validiert. Bei anderen liegt der Schwerpunkt nach wie vor auf den in der Volksheilkunde gemachten Erfahrungen. Das letztere gilt auch für die Meisterwurz, die in der traditionellen alpenländischen Naturheilkunde einen sehr hohen Stellenwert besitzt. Imperatoria gilt dabei in erster Linie als stärkendes und reinigendes Universalmittel. Laut Madaus werden dieser Heilpflanze diuretische und diaphoretische Wirkungen zugesprochen. Der Einsatz erfolgte als Begleitmittel bei nachfolgenden Indikationen: bei Schleim und Stauungen, Bronchialkatarrh, und als Stomachikum (bei Blähungen, Diarrhöe und Magenkrämpfen). Des Weiteren wurde sie als Antidot bei Vergiftungserscheinungen eingesetzt.
Inhaltsstoffe
Die Meisterwurz, Imperatoria bzw. Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. KOCH., enthält ätherisches Öl und Cumarinderivate, unter anderem Archangelicin.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.




MELISSE
Melissa officinalis L.
WESEN: Besänftigung, Weichheit, Milde
Wesen und Signatur
Signatur
«Die Zitronenmelisse ist eine der geschätztesten Heilpflanzen. Sie hat eine völlig milde, sanfte Wirkungsart und ist nie aggressiv. Sie kann problemlos – auch über längere Zeit – eingenommen werden und tut wohl jedem Menschen einmal gut. Ihre Blätter breiten sich in die Horizontale aus; es gehört zu ihrem Wesen, etwas Darunterliegendes sanft zu bedecken. Eine Reihe von Melissenpflanzen im Garten bildet allmählich ein Gewölbe. Auch die Blätter bestehen aus vielen kleinen Wölbungen, die sich zwischen dem dichten Netzwerk der ausgeprägten Nerven aufspannen. Es sind sanfte Wölbungen, wie von einer Hand, die in liebkosender Bewegung über Haare und Gesicht eines geliebten Menschen streift. Die Melisse zeigt nicht ein zugespitztes Streben nach oben, mit der Entwicklung einer Spannkraft zwischen unten und oben. Nein, sie scheint wie frei schwebend zwischen Himmel und Erde aufgespannt. Die Melisse hat sich von allen Pflanzen den Erdkräften am meisten entzogen. Wenn wir einen dichten Melissenbestand mit dem Handrücken streifen, entsteht ein Gefühl und auch ein Geräusch, das ein bisschen an trockenhäutige Blätter erinnert. Die Konsistenz der Pflanze hat etwas Derbes, das man ihr zuerst gar nicht zutraut. Ich war immer wieder überrascht von der Festigkeit frischer Melisse bei der Verarbeitung. Gefühlsmässig empfindet man die Pflanze als weich und zart und ist dann erstaunt über die Zähigkeit ihrer Blätter. Bei näherer Untersuchung stellt man fest, dass das Wesen der Leichtigkeit und Zartheit eben nicht bis in die Substanz hineingedrungen ist. Denn gerade die Festigkeit der Struktur führt dazu, dass die Melisse dieses Tragende und Schwebende zum Ausdruck bringen kann.
Streifen wir mit der Hand über frische Melisse, entfaltet sich ein zarter, lieblicher, zitronenartiger Duft. Der Gehalt an diesem wohlriechenden ätherischen Öl ist sehr gering. Ätherisches Melissenöl ist aufgrund der grossen Pflanzenmenge, die zu seiner Gewinnung erforderlich wäre, unbezahlbar. Was als «Melissenöl» feilgeboten wird, ist meistens aus dem ähnlich duftenden indischen Citronellgras gewonnen.
Das ätherische Öl der Melisse ist sehr flüchtig und instabil. Ein halbes Jahr nach der Ernte ist schon bis zu 60% des Gehalts verloren. Melissentee, der über ein Jahr alt ist, hat praktisch kein Zitronenaroma mehr, und nach zwei Jahren ist er ohne Geschmack.
Ganz anders gibt sich eine Tinktur aus frischer Melisse, die nach einem wesenerhaltenden Verfahren hergestellt wurde. Eine gewisse Zeit lang ist der zitronenartige Geruch noch vorhanden, doch später, nach einigen Jahren der Reifung, entwickelt sich ein wunderbar tragender Duft. Wer schon die Gelegenheit hatte, Lagerhäuser von verschiedenen, grossen Drogenimporteuren zu besuchen, wird festgestellt haben, dass sie alle ähnlich typisch riechen. Gemeint ist ein Geruch, bei dem nicht eine einzelne, stark riechende Droge dominiert. Die Summe vieler Heilpflanzen ergibt einen wunderbar tragenden Geruch. Genauso riecht eine gereifte wesenhafte Mellissenurtinktur.»
Wesen
«Man könnte die Zitronenmelisse als Essenz aus der Summe vieler Heilpflanzen bezeichnen. Das Individuelle, das eine bestimmte Heilpflanze auszeichnet und das in der Therapie eigentlich erwünscht ist, hat sich bei der Melisse weitgehend verflüchtigt. Zurückgeblieben ist ein unglaublich sanftes, allheilendes Wesen. Die Melisse ist eine Heilpflanze, die uns mit tiefer Dankbarkeit und Ruhe erfüllt. Ihr Wesen entspricht einer sanften, liebkosenden Berührung, es schenkt entspannte Ruhe, wenn Nervosität und Anspannung zu Magen-Darm-Störungen oder Herzbeschwerden führen.
Die Melisse gehört zum Menschen, der wie die «Prinzessin auf der Erbse» die kleinsten Unannehmlichkeiten des Lebens als hart und störend empfindet. Ein großes Harmoniebedürfnis zeichnet ihn aus. Er liebt alles Schöne, Zarte, Ebenmäßige, Liebliche. Bereits kleine Unpässlichkeiten trüben sein Lebensgefühl, und er braucht viel Zuwendung. Die Melisse wendet sich ihm zu, sie versinnbildlicht das helfende Prinzip. Einschlafschwierigkeiten, Verdauungsprobleme, nervöse Unruhe und leichte Herzbeschwerden – dort wo das Harmoniebedürfnis gestört ist – werden mit Melisse erfolgreich behandelt.»
Botanik
Die Zitronenmelisse, mit botanischem Namen Melissa officinalis L., ist eine Pflanze aus der Familie der Lippenblütler (Lamiaceae). Ihre Familienzugehörigkeit lässt sich bereits durch den wunderbaren harmonischen und intensiv zitronigen Duft erahnen, den sie bereitwillig abgibt, wenn man sie nur sanft berührt. Ein intensives Aroma ist typisch für viele Pflanzen aus der Familie. Sie stammt eigentlich aus dem Mittelmeergebiet oder Westasien, ist aber mit den Benediktinermönchen zu uns nach Mitteleuropa gelangt. Sie wird bis etwa 80 bis 100 cm hoch und ihr vierkantiger, dünner, dabei aber sehr zäher Stängel trägt die ei- bis herzförmigen und kreuzgegenständigen Blätter der Pflanze. Die Blätter sind am Rande gezahnt und in ihrer Form insgesamt leicht gewölbt. Ihre kräftigen Blattadern sind auf der Oberseite tief eingesenkt und treten daher auf der Unterseite stark hervor. Die Blätter tragen kleine Drüsen, am Stängel finden sich Drüsenhaare, welche beim Verreiben bereitwillig einen starken und harmonischen Zitronengeruch abgeben. Selbst ein einfaches Streichen über die Pflanzen reicht aus, um den flüchtigen Duft zu entfalten, er scheint kaum festgehalten zu werden. Aus den gelben Knospen, die in den Blattachseln stehen, entwickeln sich ab Juni bis in den August hinein, die weissen oder bleichvioletten unscheinbaren Blüten der Pflanze. Diese sind klar in Ober- und Unterlippe geteilt, wie es für eine Pflanze der Familie typisch ist. Die frostempfindliche Melisse wächst besonders gut auf warmen, sonnigen und nährstoffreichen Standorten.
Verwendung
Bei Melissa officinalis L. handelt es sich um eine aus dem Orient stammende Gewürz- und Heilpflanze mit langer Tradition. Ähnlich wie der Lavendel wird die Melisse nervenstärkend, beruhigend, krampflösend und als Karminativum zur Behandlung von leichten Verdauungsstörungen eingesetzt. Volksheilkundlich und in der Homöopathie gehören des Weiteren Regelstörungen zu den Anwendungsgebieten der Melisse. Des Weiteren ist die antivirale Wirkung der Melisse bei Herpes labialis bekannt und mittels Studien untersucht. Getrocknete Melissenblätter sind ein sehr beliebter Anteil von Teegemischen. Der frisch zitronenartige blumige Duft kommt jedoch nur in Frischpflanze am deutlichsten zur Geltung und kann in der Droge nach einer gewissen Zeit verschwinden, da der Gehalt an ätherischem Öl eher gering ist. Echtes Melissenöl gehört daher nebst dem Rosenöl zu den teuersten ätherischen Ölen überhaupt und bei den erhältlichen Produkten handelt es sich häufig um Verdünnungen in Trägeröl oder Lösungen anderer ätherischer Öle (z.B. Citronell / Zitronengras). Beim «Melissengeist» handelt es sich um ein Destillat aus Melissenblättern und anderen Pflanzen.
Inhaltsstoffe
Der frische, zitronenartige Geruch der Melisse, Melissa officinalis L., weist darauf hin, dass ätherisches Öl enthalten ist. Dieses setzt sich vor allem aus Citral und Citronellal zusammen. Darüber hinaus sind Phenolcarbonsäuren wie die Rosmarinsäure enthalten.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- Monographie BGA/BfArM (Kommission E). Melissae folium (Melissenblätter). Bundesanzeiger 228, (1984).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- BGA/BfArM (Kommission D). Melissa officinalis. Bundesanzeiger 172 a, (1988).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2018).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.




MISTEL
Viscum album L.
WESEN: Stille, Schwerelosigkeit
Wesen und Signatur
Signatur
«Die Mistel ist ein immergrüner, strauchförmiger Halbparasit auf Bäumen. Die Äste verzweigen sich gabelig (dichotom), das heisst, an den Verzweigungspunkten entstehen immer gleich grosse neue Äste (meistens zwei). Diese Verzweigungsart führt zu der typischen kugelförmigen Gestalt der Mistel. Die Mistelkugeln werden im Durchmesser bis zu 1 m gross. Die jüngeren Äste sind grünbraun. Die ganzrandigen, zungenförmigen Laubblätter sind olivgrün und sitzen meistens zu zweien gegenständig, seltener quirlständig an den Triebspitzen oder an den jüngeren Verzweigungsstellen. Am Ende jedes Gabelglieds ist eine blütentragende Spitze, die im Herbst und Winter die erbsengrossen weissen Früchte tragen. Diese sind sehr schleim- und klebstoffhaltig.
Wenn wir die Mistel mit der pflanzentypischen Gestalt vergleichen, fällt eine markante Abweichung auf. Die Mistel orientiert sich nicht an der Schwerkraft. Üblicherweise richtet eine Pflanze ihre Wurzeln nach unten, in die Erde und den Stengel nach oben, in die entgegengesetzte Richtung. Dies zeigt eine Wirkung der Erdenkraft auf die Pflanzen an. Für die Mistel gibt es im Wachstum kein Oben und Unten, sondern sie breitet sich vollkommen sphärisch aus. Sie kennt als Bezugspunkt nur ihren eigenen Mittelpunkt und kümmert sich nicht um die Schwerkraft.
Auch das Licht der Sonne scheint nicht die sonst übliche Differenzierung an der Pflanzengestalt vorzunehmen. Die Mistel entwickelt keine Duft- oder Geschmacksstoffe, keine Farben, keine differenzierten Blüten, Früchte oder Blattformen, die auf eine Lichtwirkung schliessen lassen. Die Mistel hat die denkbar einfachsten Formen: gabelige Verzweigungen, ovale Blätter, kugelförmige Früchte. Dies lässt darauf schliessen, dass vor allem Luft- und Wasserkräfte an der Gestaltung gewirkt haben. Wasserkräfte bilden die Blätter, und Luftkräfte strukturieren die Pflanze durch Verzweigungen.»
Wesen
«Die Mistel ist dem Wasser- und Luftelement unterstellt und entzieht sich ganz dem Wirkungsbereich der Erde und des Feuers. Auf den Menschen übertragen entsprechen die Elemente Luft und Wasser den Gefühlen und der Lebensenergie. Druck- und Spannungsunterschiede in der Atmosphäre entstehen naturgesetzmäßig durch die Einwirkung von Wärme und Erdanziehungskraft. Da die Mistel von Wärme und Erdkräften nicht berührt wird, hält sie Druck und Spannung aus ihrem Wirkungskreis fern; Stress, angespannte Gefühle und ein hitziges Gemüt sind dem Wesen der Mistel fremd. Da in solchen Gefühlszuständen eine häufige Ursache von Bluthochdruck liegt, ist ein Bezug zwischen dem Wesen der Mistel und ihrer körperlichen, blutdrucksenkenden Wirkung offensichtlich.
Viscum album vermittelt ein Gefühl der inneren Stille und Schwerelosigkeit. Patienten mit Angstzuständen, Albträumen und/oder zu starker Empfänglichkeit für Mondeinflüsse sprechen gut auf eine Behandlung mit der Urtinktur in geringer Dosierung an.»
Botanik
Eine ganz besondere Pflanze begegnet uns in der Mistel, Viscum album L. Vor allem zum Winter hin fällt Sie uns stark auf, da sie auch zu dieser Jahreszeit immer noch grün ist. Es handelt sich bei ihr um einen kugelig wachsenden Strauch, der Zeit seines Lebens niemals den Boden berührt: Die Mistel wächst auf Laubbäumen. Sie wächst sehr langsam, alte Pflanzen können nach vielen Jahrzehnten aber durchaus einen Durchmesser von 100 cm erreichen. Ihre Früchte, die von Vögeln verbreitet werden, sind klebrig und bleiben daher gerne an der Rinde von Bäumen kleben. Nach dem Austreiben des Samens durchstösst dieser mit einem Saugfortsatz die Rinde des Baumes und findet dort Anschluss an das Gefässsystem des Wirtes. Hierdurch entzieht die Mistel dann dem Wirtsbaum Wasser und Nährsalze, Photosynthese betreibt sie hingegen selbst. So an ihren Wirt «angedockt», kann die Mistel dann beginnen ihre kugelige Gestalt zu entwickeln. Die entstehenden Triebe der Pflanze verzweigen sich gabelig. Diese gabelige Verzweigung und das Wachsen bzw. «Anzapfen» eines Baumes stellen für die Pflanzen Mitteleuropas eine Besonderheit dar. An ihren kurzen Ästen stehen die dunkelgrünen, ledrigen, länglichen und ganzrandigen Laubblätter. Sie können bis 8 cm lang werden. Die Mistel ist zweihäusig, es gibt also männliche und weibliche Pflanzen. Ihre unscheinbaren gelbgrünen Blüten erscheinen von Februar bis April, zu dieser Zeit sind die Blätter der Wirtsbäume meist noch nicht entwickelt. Als weitere Besonderheit stehen die Blüten der Misteln mittig, als Fortsetzung des Stängels und nicht in den Blattachseln wie bei den anderen Vertretern der Familie. Die Blütenbildung beendet das Wachstum für das Jahr, weshalb man das Alter der Misteln auch einfach bestimmen kann: Jedes Gabelstück entspricht einem Wachstumsjahr. Nach der Befruchtung bilden sich die weissen und längsgestreiften Früchte mit ihrem schleimig klebrigen Fruchtfleisch. Sie werden erst im November oder Dezember, teilweise sogar erst zu Beginn des folgenden Jahres reif.
Verwendung
Bei der Mistel, Viscum album L., handelt es sich um eine ganz besondere Kultur- und Heilpflanze, welcher magische und glücksbringende Eigenschaften zugeschrieben werden. In der Weihnachtszeit trifft man den Mistelzweig häufig in Türrahmen vieler Häuser an. Als Heilpflanze wurde die Mistel traditionell bei unterschiedlichen Herz-Kreislauf-Beschwerden, insbesondere bei hohem Blutdruck, Schwindelgefühlen und Herzrhythmusstörungen, eingesetzt. Die Römer stellten aus den Mistelbeeren den sogenannten Vogelleim her. Damit wurden Äste bestrichen, um angelockte Vögel zu fangen. Diese klebrige Eigenschaft kann man selbst wahrnehmen, wenn man Mistelbeeren zwischen den Fingern zerdrückt.
Inhaltsstoffe
Die Mistel, Viscum album L., ist bekannt für ihren Gehalt an zuckerbindenden Glykoproteine – den sogenannten Lectinen. Weitere Inhaltsstoffe sind: Triterpene, Polysaccharide, Flavonoide und biogene Amine.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment report on Viscum album L ., herba. EMA/HMPC/246778/2009 (2012).
- BGA/BfArM (Kommission D). Viscum album. Bundesanzeiger 217a, (1985).
- BGA/BfArM (Kommission E). Visci albi herba (Mistelkraut). 1Bundesanzeiger 228, (1984).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2018).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.




PASSIONSBLUME
Passiflora incarnata L.
WESEN: Herzensruhe, zu sich selbst finden, der ureigene innere Ton
Wesen und Signatur
Signatur
«Die verschiedenen Passiflora-Arten sind ausdauernde Kletterpflanzen, die aus den warmen Zonen des amerikanischen Kontinents stammen und schon seit Jahrhunderten ihrer schönen Blüten wegen als Zierpflanzen bei uns angebaut werden. Die Blüten sind wunderschön, aber auch sehr vergänglich, sie blühen nur einen Tag. Das Besondere an den Blüten sind die vielen konzentrischen Kreise, die wir in ihrem Bild erkennen können. Wenn wir die Blüte von oben betrachten und an der Peripherie mit unserer Untersuchung beginnen, erkennen wir einen Strahlenkranz aus 10 Blütenblättern, deren Zipfel einen äussersten Kreis bilden. Schauen wir die Blüte nun von unten etwas genauer an, sehen wir, dass die 10 «Blütenblätter» aus 5 unterseits grünen Kelchblättern und den 5 dazwischen stehenden, unterseits farbigen Kronblättern bestehen. Die Pflanze hat durch diese farbliche Angleichung von Kelch und Krone auf der Oberseite eine Vereinheitlichung, eine Harmonisierung vorgenommen. Das wohl auffälligste Merkmal der Blüte ist die Nebenkrone innerhalb der schon erwähnten Kronblätter, bestehend aus unzähligen feinen Fäden. Diese Fäden sind in 4 Kreisen konzentrisch um die Blütenachse angeordnet. Der äusserste Kreis besteht aus sehr langen, auf den Blütenblättern liegenden Fäden, die wie feine Linien nach aussen strahlen. Sie sind abwechselnd dunkelpurpur, weiss und hellpurpur gefärbt, was mehrere konzentrische Farbringe ergibt. Nun folgen die inneren Fadenkreise, die aus sehr kurzen, borstigen Stummeln bestehen. Weiter innen liegt dann der Kreis der 5, unten zu einer Röhre verwachsenen Staubblätter und zuinnerst, im Mittelpunkt, sehen wir den Fruchtknoten mit den 3 markanten Griffeln. Insgesamt zählen wir in einer Blüte 10 konzentrische Kreise. Es ist offensichtlich, dass bei der Gestaltung dieser Blüte Kräfte am Werk waren, die einen wesenhaften Bezug zur Kreisform haben. Die intuitive Betrachtung des Wesens dieser Pflanze bestätigt diese Erkenntnis: Wir sehen eine unruhige Wasseroberfläche mit sich kräuselnden Wellen. Dann beginnen sich die ungeordneten Wellen zu legen, und es entstehen grosse, konzentrische Wellenringe, die sich auf ihren Mittelpunkt zu bewegen und kleiner werden. Diese Mitte ist unser Herz. In der Mitte lösen sich nach und nach alle Wellenringe auf. Zurück bleibt eine ruhige, spiegelglatte Wasserfläche. Das soeben geschilderte Bild der inneren Wahrnehmung ist genau das Gegenteil von dem Bild, das entsteht, wenn man in ein ruhiges Wasser an derselben Stelle mehrmals hintereinander einen Stein hineinwirft. Jeder Steinwurf verursacht einen neuen Wellenring, insgesamt sind es mehrere Ringe, die sich von der gemeinsamen Mitte zentrifugal ausbreiten und schliesslich die ganze Wasserfläche unruhig werden lassen. Die Passionsblume hat einen zentralen Bezug zum «psychischen» Herzen wie auch zum körperlichen Organ des schlagenden Herzens. Mit ihrem Wesen vermag sie die Unruhe des Herzens zu stillen. Ein wesenhaftes Heilmittel aus Passiflora wird vor allem bei Unruhezuständen infolge Herzensangelegenheiten, bei Angst, sorgenvollen Gedanken, Verlustängsten usw. angewandt.»
Wesen
«Die Passionsblume besitzt eine besondere Beziehung zum Herzen. Sie symbolisiert die Herzensruhe, das «Im-Einklang-mit-sich-selbst»-Sein. Passiflora schenkt Herzensruhe und unterstützt den Prozess des Abschiednehmens. Der Mensch schreitet von Lebenskreis zu Lebenskreis und durchlebt dabei Metamorphosen. Immer wieder muss er Abschied nehmen von etwas, das seinen Zweck erfüllt hat. So kann sich das Alte umwandeln in das Neue, Höhere. Kann er den Abschied bejahen, beflügelt ihn das. Festhalten und Auflehnung ziehen ihn herunter und werden zum Quell von Unruhe und Sorge.
Der Erwachsene lehnt sich häufig dagegen auf, Bekanntes, Liebgewordenes loszulassen. Das Kind hingegen reagiert unmittelbar, unbewusst, direkt körperlich auf Veränderung. Die Folge davon können Bewegungsunruhe, Hyperaktivität oder aber Teilnahmslosigkeit und Rückzug sein. Wer selten Momente findet, die innere Ruhe zu pflegen, oder gleichzeitig in verschiedene Richtungen gezogen wird, läuft Gefahr, sich zu verlieren. Das Wesen der Passiflora besitzt die Eigenschaft, Menschen aus der Peripherie des Lebens wieder zu sich selbst zurückfinden zu lassen. Sie verhilft dazu, den ureigensten inneren Ton wieder zu hören, wirkt lösend, ausgleichend und schenkt Ruhe. Der Mensch wird so in seiner Mitte gestärkt.»
Botanik
Passiflora incarnata L., die Passionsblume, gehört zur Familie der Passifloraceae (Passionsblumengewächsen). Diese sind, vor allem in den Tropen und Subtropen von Süd- und Mittelamerika verbreitet. Die meisten Arten sind frostempfindlich, Passiflora incarnata L.hingegen weist eine gewisse Frosthärte auf. Passiflora incarnata L. ist ein ausdauernder Kletterstrauch, der 5-10 m lange dünne, dabei aber überraschend feste, Stängel ausbildet. An diesen stehen die tief dreilappigen Blätter wechselständig. Zusätzlich werden lange, einfache Ranken ausgebildet, die im äussersten Teil korkenzieherartig eingerollt sind und mit denen sich die Pflanze nach oben «zieht». Bei warmer und sonniger Witterung kann die Pflanze einen starken kohlartigen Geruch verströmen.
Passiflora incarnata L. blüht in den Monaten Juni bis September mit ihren typischen, ausdruckstarken Blüten. Nimmt man sich die Zeit und lässt diese auffälligen Blüten auf sich wirken, so ziehen diese den Betrachter in ihren Bann. Sie scheinen aus einer Vielzahl konzentrischer Kreise zusammengesetzt zu sein. Zunächst auffallend sind die 10 strahlenförmig nach aussen gerichteten, von oben gleichförmig weiss aussehenden Blütenblätter. Dreht man die Blüten jedoch um, so erkennt man plötzlich, dass sich diese von oben einfarbigen Blütenblätter in 5 weisse Kron- und 5 grüne Kelchblätter unterteilen. Ihre Schauwirkung wird noch durch eine fadenförmige Nebenkrone verstärkt, diese ist violett-weiss gebändert. Bewegt man sich vom Rand auf das Zentrum der leicht duftenden Blüte zu, folgen als nächste Struktur die 5 Staubblätter, die weit ausladend an der Mittelsäule der Blüte stehen. Im Mittelpunkt dieses eindrucksvollen Gebildes steht schliesslich der Fruchtknoten mit seinen drei markanten Griffeln. Diese aussergewöhnlichen und wunderschönen Blüten sind sehr schnell vergänglich, jede von ihnen erstrahlt nur für etwa einen Tag in ihrem Glanz. Die Früchte der Passiflora incarnata L. sind leider nicht so schmackhaft wie die Früchte anderer Arten der Gattung, welche wir als Maracuja kennen.
Verwendung
Die Passionsblume, Passiflora incarnata L., stammt ursprünglich aus dem südlichen Nordamerika. Sie wird einzeln oder auch gemischt in Fertigarzneimitteln verwendet. Die Passionsblume ist bekannt für Ihre beruhigende, angstlösende Wirkung. Folglich können diese bei nervöser Schlaflosigkeit, Schlafstörungen, Unruhe- und Spannungszustände, Stress, Stimmungsschwankungen Krämpfen und Neurasthenie eingesetzt werden. Funktionelle und nervöse Herzbeschwerden, naturheilkundlich als Herzneurose bezeichnet, sind ein besonderer Anwendungsschwerpunkt der Passionsblume.
Inhaltsstoffe
Die Passionsblume, Passiflora incarnata L., enthält Flavonoidverbindungen (gemäss Ph. Eur. enthält Passionsblumenkraut mindestens 1.5 % Glykosylflavone berechnet als Vitexin) und cyanogenes Glykosid (Gynocardin). Neben Maltol zählen weitere Zuckerverbindungen zu den Bestandteilen. Ätherisches Öl ist bei der Passionsblume nur in Spuren vorhanden.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- BGA/BfArM (Kommission E). Passiflorae herba (Passionsblumenkraut). Bundesanzeiger 223, (1985).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- BGA/BfArM (Kommission D). Passiflora incarnata. Bundesanzeiger 190 a, (1985).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment report on Passiflora incarnata L ., herba. EMA/HMPC/669738/2013 (2014).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.




RINGELBLUME
Calendula officinalis L.
WESEN: Balsam, Verschliessen von Wunden
Wesen und Signatur
Signatur
«Die Ringelblume ist eine sehr beliebte Gartenpflanze, die wenig Ansprüche an Standort und Pflege stellt. Wenn man sie sich selbst überlässt, sorgt sie für sich und sät sich immer wieder neu aus. So kann sich unser Auge und Herz vom frühen Sommer bis zum späten Herbst an ihren leuchtenden gelben und orangen Farbtönen erfreuen. Die Leuchtkraft der Farben bringt pure Lebenslust und wahre Sinnenwärme zum Ausdruck. Eine grössere Fläche von dicht an dicht stehenden Ringelblumenblüten hat eine Ausstrahlung von ungebrochener Lebendigkeit, die wohl kaum zu übertreffen ist. Man kann vor dem inneren Auge förmlich sehen, wie das intensive Lebensenergiefeld über der Oberfläche der Blüte in flächiger Bewegung webend wirkt. Nicht nur die Blüten haben einen besonderen Bezug zur Peripherie. Nimmt man ein Bündel geschnittener Pflanzen in die Hand und drückt sie mehrmals ein wenig, bemerkt man eine leicht klebrige, balsamische Substanz, die alle Pflanzenteile überzieht und ein wunderbar warmes Aroma verbreitet. Haben wir oben von der ungebrochenen Vitalität und Fruchtbarkeit der Ringelblume gesprochen, kommen wir nicht umhin zu erwähnen, dass die inneren Röhrenblüten des Blütenkorbs (Calendula gehört zur Familie der Korbblütler) unfruchtbar sind. Ein Widerspruch? Nein, ein wunderbares Zeichen der Signatur, denn nun erfahren wir, woher die Ringelblume ihren Namen hat. Ihre Früchte krümmen und ringeln sich und werden ganz unterschiedlich gross. Die Früchte der fruchtbaren Randblüten krümmen sich alle mehr oder weniger weit nach innen, bis sie die ganze unfruchtbare Innenfläche vollständig zugedeckt haben. Wenn man es nicht genau untersucht, käme man gar nicht auf die Idee, dass die Ringelblumenfrüchte nicht aus der ganzen Blütenscheibe stammen. Einen weiteren «Verschlussmechanismus» bemerken wir, wenn wir Blüten sammeln und sie am Stiel abschneiden. Nach kurzer Zeit hat sich an der Schnittstelle ein weisser, abdichtender Überzug gebildet. An der Schnittstelle austretender Pflanzensaft hat sich zu einer kompakten Schicht verfestigt. Es versteht sich von selbst, dass sich eine Pflanze mit derart eindrücklicher Wesenskraft nicht nur auf das Verschliessen von körperlichen Wunden versteht. Auch seelische Wunden erfahren durch diese sonnenhafte Pflanze eine Linderung.»
Wesen
«Wohl kaum eine andere Pflanze ist von ihrer Natur her so vorzüglich zum Wundheilkraut geeignet. Ihr balsamisches, warmes Wesen ist völlig auf das Verschließen von Verwundungen ausgerichtet. Wie mit Lichtfäden schließt die Pflanze das gestörte Energiefeld über der Wunde und versorgt es mit neuen Kräften, um eine rasche Heilung zu fördern. Die geringelten Früchte der Ringelblume bedecken den Blütenboden von außen nach innen und verschließen die offene, «wunde» Stelle im Innern. Fasst man eine Ringelblume mit den Händen, um sie zu pflücken, hinterlässt sie auf der Haut ein einzigartiges, klebriges Sekret. Ihre Fähigkeit, Wunden zu «verkleben» und zu verschließen, ist herausragend. Sie besitzt eine intensive innere Wärme und wirkt dadurch entzündungswidrig und desinfizierend. Sie enthält Sonnenkraft, bildet sie doch die dauerhaftesten Blüten im Kräutergarten und trotzt gar noch der Novemberkälte. Calendula heilt Hautrisse, fördert die Wundheilung und wirkt mit ihrer tröstenden, balsamischen Kraft bis in seelische Prozesse.»
Botanik
Die Ringelblume (Calendula officinalis L.) gehört zur Familie der Korbblütengewächse (Asteraceae). Sie ist eine einjährige Pflanze mit einem charakteristischen Geruch, der an den Duft von Harz erinnert. Berührt oder erntet man die Pflanze, so wird die Haut sofort mit dieser balsamisch duftenden, klebrigen Substanz überzogen. Die Ringelblume wird 30 – 70 cm hoch, an einem aufrechten, filzig behaarten Stängel stehen die ungeteilten spatelförmig, bis lanzettlichen Blätter. Die Ringelblume blüht von Juni bis in den Oktober hin und erfreut uns mit ihren 2 – 5 cm grossen, strahlenden, gelben, bis orangefarbenen Blüten, die von aussen nach innen aufblühen. Sie ist eine so vitale Pflanze, dass sie immer wieder neue Blüten hervorbringen kann, sofern man die alten Blüten regelmässig entfernt. Typisch für einen Korbblütler sind die Blüten, die in Wahrheit keine Einzelblüten, sondern Blütenstände sind, aus Zungen- und Röhrenblüten zusammengesetzt. Im Unterschied zu den anderen Arten der Pflanzenfamilie sind bei der Ringelblume die eigentlich fruchtbaren inneren Röhrenblüten unfruchtbar, während die äusseren Zungenblüten fruchtbar sind. Als weitere Besonderheit bildet die Pflanze verschieden geformte Fruchttypen aus.
Verwendung
Die bereits seit Jahrhunderten in Kräutergärten kultivierte Ringelblume gehört zu den bekanntesten wundheilungsfördernden Heilpflanzen überhaupt. Calendula kommt dabei als getrocknete Teedroge und aufgrund der schönen gelben Farbe auch als Schmuckdroge in Kräuterteemischungen zum Einsatz. Weitere übliche Formen der Zubereitung sind Fluidextrakte und alkoholische Tinkturen. Darüber hinaus wird durch Mazeration mit pflanzlichen Ölen (z.B. Olivenöl) aus den Ringelblumen das Calendulaöl zur äusserlichen Anwendung gewonnen. Aufgrund der entzündungshemmenden Eigenschaften zählen Verletzungen und schlecht heilenden Wunden im Bereich von Haut und Schleimhaut zu den Anwendungsschwerpunkten. Dabei eignet sich sowohl die innerliche wie auch die äusserliche Anwendung. Für die Anwendung zur Schleimhautpflege im Bereich von Mund und Rachen eignen sich Teezubereitungen oder Gurgellösungen, die ganz einfach mit einigen wenigen Tropfen der Tinktur hergestellt werden können. Äußerlich werden, die arzneiliche Zubereitungen aus Calendula officinalis enthalten, lokal auf der Haut angewendet.
Inhaltsstoffe
Bei der Ringelblume findet sich ein Spektrum verschiedener Inhaltsstoffe wie Triterpenalkohole, Triterpensaponine, Flavonoide, Polysaccharide und kleine Mengen von ätherischem Öl, bestehend aus Sesquiterpenen. Die Färbung wird durch gelbe Xanthophylle und orangefarbene Carotinoide hervorgerufen.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- BGA/BfArM (Kommission D). Calendula officinalis (Calendula). Bundesanzeiger 190a, (1985)..
- European Medicines Agency. European Union herbal monograph on Calendula officinalis L., flos. Eur. Med. Agency 44, 0–7 (2018).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.




ROSMARIN
Rosmarinus officinalis L.
WESEN: Feuer, Begeisterung
Wesen und Signatur
Signatur
«Unter Therapeuten kennt man die Aussage: «Was der Rosmarin für den Geist, ist der Lavendel für die Seele.» Es ist also bekannt, dass Rosmarin den Geist anregt. Im Zusammenhang mit Geist und Begeisterung sprechen wir auch von Feuer, vom «feu sacré». Nun wissen wir, dass nur derjenige klar denken kann, der einen kühlen Kopf bewahrt. Feuer ist aber heiss, und ein hitziger Kopf kann kaum geistreich sein. Gibt es hier keinen Widerspruch? Feuer ist nicht nur heiss, sondern es strahlt auch Licht aus, und sein Flammenspiel ist sehr beweglich. Das Feuer unserer Lebensspenderin, der Sonne, nährt mit seiner Hitze das Herz und den Blutkreislauf, mit seinem Licht und seiner Bewegungskraft den Kopf und die Gedanken und mit seiner ätherischen Energie das Sonnengeflecht und die Lebensprozesse. Von diesen feurigen Eigenschaften vermittelt der Rosmarin vor allem die Hitze und die Beweglichkeit. Wird das ätherische Rosmarinöl auf die Haut eingerieben, entwickelt sich eine intensive Erwärmung und Rötung, weil die Durchblutung angeregt wird. Innerlich eingenommen, entfaltet der Rosmarin eine sehr dynamische Feuerwirkung auf Herz und Kreislauf. Darin liegt die Heilkraft bei Kreislaufbeschwerden und rheumatischen Erkrankungen begründet. Das Beweglichkeitsprinzip der Flammen erkennen wir beim Rosmarin in der Gestalt der Blätter. Erinnern sie uns nicht an schmale Flammenzünglein? Da die länglichen, nadelförmigen Blätter eng am Trieb nach oben gerichtet sind, nehmen wir meist nur deren Unterseite wahr, die in der Mitte einen hellen Längsstreifen hat. Dieser entsteht dadurch, dass sich die grüne, kahle Blattoberseite nach der dicht weissfilzig behaarten Unterseite umrollt. So ist von der Unterseite nur noch ein schmaler heller Mittelstreifen sichtbar. Die Flämmchen mahnen aufgrund ihrer Farbe weniger an ein Licht erzeugendes Feuer als an Gasflämmchen. In der inneren Wahrnehmung erscheint uns der Rosmarin als ein Busch mit unzähligen auf und ab flackernden Flämmchen, die wie aus kleinen, aus dem Holz hervorgestossenen Gaseruptionen explosionsartig entstehen und wieder vergehen. So vermittelt uns die Intuition ein Bild für die enorme Beweglichkeit und Leichtigkeit des Feuers und damit eine Analogie für die Beweglichkeit und Leichtigkeit des Geistes, die Fähigkeit, im Geist zu entflammen, sich zu begeistern. Im Übrigen unterstreicht die reale Möglichkeit des Entflammens das intuitive Bild: Das ätherische Rosmarinöl hat die grösste Flüchtigkeit aller ätherischen Öle. An sehr heissen Tagen kann es (in den Hauptanbaugebieten der Mittelmeerländer) geschehen, dass über einem grossen Feld die Konzentration des Rosmarinöls so hoch ist, dass ein Funke Teile des Felds entzündet.»
Wesen
«Das Wesen des Rosmarins entzündet den Geist, begeistert. Wenn man sich für nichts mehr begeistern kann, wenn das »feu sacré« erloschen ist und Lethargie sich einschleicht, fehlt auch dem Blutkreislauf das dynamisierende Prinzip. Rosmarin feuert an, schenkt Energie, regt den Blutkreislauf an, durchwärmt das Blut und beugt Blutarmut vor. Zum Beispiel Menschen, die großen Einsatz und Engagement in sozialen Berufen zeigen, sind meist selbst sehr begeisterungsfähig und können Mitarbeiter und Kolleginnen mit ihrer Begeisterung anstecken, ein gutes Umfeld schaffen und hohe Ziele erreichen.
Oft aber denken gerade diese Menschen nicht daran, ihre eigenen «Batterien» wieder aufzuladen; die Umgebung stützt sich zu sehr auf sie und rechnet selbstverständlich mit ihrer uneingeschränkten Präsenz. Es kommt zum Burn-out-Syndrom. Derselbe Mensch, der früher mit viel Liebe zur Sache und sprühender Freude anderen dienstbar war, ist nun leer und ausgebrannt. Er kann sich für nichts mehr erwärmen, sich an nichts mehr freuen, ihm fehlt die Kraft dazu. Rosmarin regt den Blutkreislauf an und durchwärmt Körper und Seele mit seinem aromatischen, feurigen Wesen. Er stärkt Magen und Bauchspeicheldrüse und wirkt tonisierend. Wenn junge Frauen an Blutarmut leiden, ihre Gesichtsfarbe bleich ist und der Kreislauf schwach, hilft Rosmarin; er wirkt Blutarmut entgegen, stabilisiert den tiefen Blutdruck und verbessert den Kreislauf. Rosmarin besitzt die Kraft, den Menschen aufzurichten, vertreibt Lethargie und vermittelt wieder Freude am Leben.»
Botanik
Der Rosmarin, Rosmarinus officinalis L., ist ein aromatisch riechender, immergrüner Halbstrauch, der bis 200 cm hoch wird. Er gehört zur Familie der Lippenblütler (Lamiaceae) und ist wie viele Arten der Familie durch ein starkes und typisches Aroma ausgezeichnet. Seinen Duft kann man als anregend und feurig beschreiben, dieser wird durch das leicht flüchtige ätherische Öl der Pflanze hervorgerufen. Heimisch ist der wärmeliebende Rosmarin im mediterranen Küstenbereich, er ist aber mittlerweile in ganz Mitteleuropa verbreitet und überwintert hier auch in geschützten Lagen. Die ganze Pflanze hat eine starke Tendenz zur Verholzung, sowohl in ihren Wurzeln als auch den oberirdischen Teilen. Nur die jungen Triebe des jeweiligen Jahres sind frisch, grün und unverholzt. An allen oberirdischen Teilen stehen die ganzrandigen und breit-nadelförmigen Laubblätter des Rosmarins. Sie sind in zahlreichen Quirlen angeordnet und sind unterseits dicht mit kleinen Haaren besetzt. Die Unterseite wirkt dadurch weisslich, was noch durch die umgefalteten grünen Blattränder betont wird. Sehr zeitig im Jahr, noch in der kühlen Phase des Frühjahrs, blüht die Pflanze bei uns und erfreut uns mit ihren schönen blassblauen Lippenblüten.
Verwendung
Der sonnenliebende Rosmarinstrauch wird im gesamten mediterranen Raum angebaut, um daraus mit Hilfe von Wasserdampfdestillation ätherisches Öl zu gewinnen. Dieses Öl findet Anwendung in der Parfümindustrie und auch in vielen medizinisch-kosmetischen Produkten wie Salben, Massageöle, Badezusätze und Seifen. Viele dieser Produkte zielen vor allem als hyperämisierende resp. wärmende Einreibung auf eine lokale Anregung der Hautdurchblutung, ab. Dieser Effekt eignet sich für die äusserliche Behandlung rheumatischer Erkrankungen und Kreislaufbeschwerden. Aufgrund der antioxidativen, konservierenden Eigenschaften sind Rosmarinblätter auch ein beliebter Zusatz in Lebensmitteln und dienen auch als beliebtes Küchengewürz. Arzneilich wird Rosmarin officinalis L. als Karminativum und Stomachikum bei Verdauungsstörungen eingesetzt, da es den Magen- und Darmtrakt tonisiert. Laut Madaus ist diese Heilpflanze auch ein gutes Tonikum bei Erschöpfungszuständen, Gedächtnisschwäche und Schwindel (z.B. bei niedrigem Blutdruck). Die Homöopathie wendet Rosmarin bei Regelstörungen an. Aufgrund der tonisierenden Wirkung von Rosmarin liegt der Anwendungsschwerpunkt aus naturheilkundlicher Sicht dabei vor allem im Bereich der Amenorrhoe und Oligomenorrhoe.
Inhaltsstoffe
Rosmarin officinalis L. enthält als Hauptwirkstoff ätherisches Öl, welches typischerweise α-Pinen, 1,8-Cineol, Campher, Borneol als Einzelstoffe enthält. Darüber hinaus ist die Rosmarinsäure oder „Labiatengerbstoff“ ein weiterer wichtiger Inhaltsstoff. Außerdem sind Diterpen-Bitterstoffe wie Carnosol, Rosmanol, Rosmadial enthalten.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- Wichtl, M. et al. Teedrogen und Phytopharmaka. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 1997).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Community herbal monograph on Rosmarinus officinalis L ., folium. EMA/HMPC/13633/2009 (2010).
- BGA/BfArM (Kommission D). Rosmarinus officinalis. Bundesanzeiger 86, (1994).
- Hänsel, R., Keller, K., Rimpler, H. & Schneider, G. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis Band 5 Drogen P-Z. (Springer Verlag Berlin Heidelberg, 1994).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.




ROSSKASTANIE
Aesculus hippocastanum L.
WESEN: Aufrichtekraft, Leichtigkeit, Selbstkontrolle, Sammlung, Ernst und Fröhlichkeit, Licht im Dunkel
Wesen und Signatur
Signatur
«Schon im Januar beginnen sich die Knospen der Rosskastanie stark zu vergrössern und mit einer glänzenden, klebrigen Schicht zu überziehen. Ihre pralle Wölbung verheisst eine reiche Substanzbildung. Wenn sie sich dann im Frühling weit öffnen und die Blätter aus ihrer Umhüllung entlassen, sind diese schon zu gross und schwer und doch noch zu schwach, um sich aufzurichten. Schlaff hängen die Teilblätter am schräg nach oben gerichteten Blattstiel nach unten. Wie die Glieder unbelebter Marionetten fallen die Teilblätter in sich zusammen, nur am einen Punkt des Stielendes gehalten. Nach und nach werden sie von einer aufrichtenden Kraft wie an Fäden emporgezogen, bis sie die richtige, waagrechte Lage einnehmen, um sich dem Sonnenlicht hinzuwenden.
Die Blätter sind handförmig gefiedert mit 5 bis 7 Teilblättern. Alle Teile entspringen einem zentralen Punkt am Ende des Blattstiels. Von hier aus wird die ganze Blattgestalt zusammengehalten, genährt und kontrolliert. Eine seltene Blattstruktur; meist verzweigen sich die Fiederblätter je seitlich von einer durch die Mitte der Blattkomposition geführten Achse. Haben sich die Blätter einmal in die Ebene ausgebreitet, ist die Blütenbildung schon fortgeschritten. Wie Blütenlichterkerzen schmücken die weissen Blütenstände Frühling für Frühling die Baumkronen der Kastanien. Aus der Nähe betrachtet, versuchen wir die Blüte in ihrer Struktur zu verstehen und nachzuvollziehen, wie sich die einzelnen Kron- und Staubblätter zueinander fügen. Ein schwieriges Unterfangen! Nur mit angestrengter Gedankenkraft wird die Ordnung der Rosskastanienblüte erfassbar. Doch vergessen wir die Botanik und geben wir uns der Ausstrahlung dieser Blüte hin. Ihre strahlend weissen Kronen mit den leuchtend roten und gelben Farbtupfern im Schlund sind einfach prächtig anzusehen. Später, im Sommer, hat die Rosskastanie mit ihrem dichten Blattwerk eine völlig geschlossene Baumkrone gebildet, die den Sonnenstrahlen jeglichen Durchgang auf den Grund verwehrt; ein perfekter Schattenspender. Deshalb ist dieser Baum so beliebt in Gartenrestaurants. Im Herbst freuen sich die Kinder an den prallen braunen Samen, den Kastanien. Umschlossen von einer fleischigen und stacheligen grünen Fruchtschale reifen die Samen heran. Dann spaltet sich die Fruchtschale und lässt die Samen zur Erde fallen. Der Glanz der frisch «geschlüpften» Kastanien verblasst nach kurzer Zeit; er scheint nicht für die Aussenwelt bestimmt, er wirkt im Innern der Frucht. Zusammengefasst erkennen wir in der Rosskastanie aufrichtende und zentral kontrollierende Kräfte sowie die Durchdringung des abgedunkelten Innenraums mit lichthaftem Weiss, leuchtenden Farben und spiegelndem Glanz.»
Wesen
«Die Rosskastanie besitzt die Kraft, den Menschen aufzurichten; sie bringt Prozesse, die der inneren Führung entgleiten, sich dadurch in Belanglosem, Unwichtigem verlieren und selbständig machen, wieder unter Kontrolle. Unkontrollierte, kreisende Gedanken und ein Mangel an innerer Führung werden durch das Wesen der Rosskastanie positiv beeinflusst ebenso wie das Blut, das infolge venöser Insuffizienz nicht mehr ungehindert zum Herz zurückfließen kann. Eine Schwäche der inneren Führung kann sich in einer oberflächlichen Fröhlichkeit (einem Mangel an Ernst) oder in einer übertriebenen Ernsthaftigkeit äußern. Das Wesen der Rosskastanie fördert den angemessenen Wechsel und das richtige Maß von Ernst und Fröhlichkeit. Der Aesculus-Typ ist ernstund tendenziell schwermütig. Er trägt Verantwortung mit großer Hingabe bis zur Verleugnung seiner eigenen Bedürfnisse. Es fehlt ihm die Leichtigkeit, er kann nicht spielerisch mit Situationen und Tatsachen umgehen und neigt zu Schuldgefühlen. Er empfindet ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle; mit belastenden Ereignissen beschäftigt er sich tagelang, «kaut sie wieder» und kann sie nicht loslassen. Er lässt sich zuweilen von der Last der Verantwortung niederdrücken, es können Kreuzschmerzen entstehen. Durch den Einfluss der Rosskastanie können Körper und Psyche wieder aufgerichtet werden. Die positive Energie der Rosskastanie wird symbolisiert durch das Kind, das noch spielerisch und mit Begeisterung jeder Situation mit Interesse und Neugierde begegnet. Es verbreitet eine sprühende, lichtvolle Freude. Mit derselben Leichtigkeit rollt die reife Frucht der Kastanie glänzend, rund und frisch aus der geplatzten Schale.»
Botanik
Die Rosskastanie (Aesculus hippocastanum L.) ist ein sommergrüner, relativ kurzlebiger Baum, der bis 35 m hoch werden kann. Er gehört zur Familie der Seifenbaumgewächse (Sapindaceae) und tritt in Mitteleuropa nur angepflanzt oder verwildert auf. Seine eigentliche Heimat ist Südosteuropa. Der Baum hat einen kurzen Stamm der oft Drehwuchs aufweist, sein Holz ist hell und weich. Aus seinen klebrigen Knospen entfalten sich im Frühjahr die typischen, grossen Laubblätter, die im Gegensatz zu allen einheimischen Baumarten gefingert sind. Die 5 bis 7 Teilblätter hängen anfangs schlaff nach unten, richten sich aber später auf und breiten sich dann waagrecht aus. Die Blüten erscheinen in den Monaten Mai bis Juni und stehen in reichblütigen Blütenständen zusammen. Die weissen Blüten weisen Saftmale auf, die zuerst gelb, nach der Bestäubung rot sind. Insekten erkennen diesen Farbumschlag und fliegen die bestäubten Blüten nicht mehr an. Früchte entwickeln sich nur in den unteren Teilen der Blütenstände, da wegen ihrer Schwere nur ein kleiner Teil der Blüten zu Früchten heranwachsen kann. Der Samen ist in eine grüne stachelspitzige Fruchtschale verpackt, welche sich beim Aufprall auf den Boden öffnet und den wunderbar glänzenden braunen Samen freigibt.
Verwendung
Die Rosskastanie ist ein klassisches Venenmittel. Verwendet werden die Samen z.B. direkt als Tee oder in Form von Fertigarzneimitteln. Schwerpunkt der Anwendung in der Pflanzenheilkunde ist die chronisch venöse Insuffizienz. Die Homöopathie wendet Aesculus hippocastanum zudem bei Lenden- und Kreuzbeinschmerz an. Die Folgen des stagnierenden Blutrückflusses im Venensystem sind äußerst vielfältig. Im Bereich der Beine empfinden die Betroffenen zumeist Schwellung, Schmerzen, Schweregefühle und Juckreiz. Vielfach kommt es zu nächtlichen Wadenkrämpfen. Zudem besteht auch eine ausgeprägte Neigung zu Ödemen und Krampfaderbildung. In schwerwiegenden Fällen kommt es zu Thrombosen oder Ulcus cruris. Aus der Rosskastanie gewonnene Arzneimittel können hier aufgrund ihrer gefäßabdichtenden, ödemprotektiven, venentonisierenden und entzündungshemmenden Eigenschaften Linderung verschaffen. Pfortaderstau und Hämorrhoidalleiden sind ebenfalls Teil des venösen Symptomenkomplexes. Bei Sportverletzungen mit lokaler Ödembildung und Blutergüssen kann Aesculus hippocastanum auch äußerlich angewendet werden.
Inhaltsstoffe
Charakteristische Inhaltsstoffe für Aesculus hippocastanum L. sind die Triterpensaponine. Als wichtigster Inhaltsstoff wird Aescin angesehen. Darüber hinaus finden sich Flavonoide v.a. Glykoside des Quercetins und des Kämpferols. In den Samen der Rosskastanie kommen zudem auch Zucker, Stärke, Polysaccharide, fettes Öl, Proteine und Mineralstoffe vor.
Referenzen
- BGA/BfArM (Kommission D). Aesculus hippocastanum (Aesculus). Bundesanzeiger 190 a, (1985).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Community Herbal Monograph on Aesculus Hippocastanum L., Semen. (2009).
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Kalbermatten R, Kalbermatten H. Pflanzliche Urtinkturen. 7th ed. AT Verlag, Aarau, Schweiz; 2014.
- Kalbermatten R. Wesen Und Signatur Der Heilpflanzen. 9th ed. AT Verlag, Aarau, Schweiz; 2016.
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.




RUPRECHTSKRAUT
Geranium robertianum L.
WESEN: Ziehen, Reinigen, Entgiften, Lösen von Schockzuständen, Lymphmittel
Wesen und Signatur
Signatur
«Seit meiner Kindheit ist mir immer wieder eine Pflanze aufgefallen, die an Stellen wächst, wo man sich nicht sehr wohl fühlt, beispielsweise in einem vermoosten Hinterhof in der Altstadt, umgeben vom Geruch von abgestandenem Katzenurin und Mauerasseln, die unter hochgehobenen Steinen oder Brettern panikartig das Licht fliehen… Später lernte ich den Namen dieser Pflanze kennen: das Ruprechtskraut. Natürlich findet man es auch an schönen Standorten, in den Wäldern oder an feuchten, schattigen Stellen unter Gebüschen. Auffällig ist jedoch, wie häufig das Ruprechtskraut an Orten mit unreiner Ausstrahlung zu finden ist.
Passend zur Standortwahl hat das Ruprechtskraut auch einen unangenehmen Geruch. Dies kommt in seinem anderen Namen Stinkender Storchenschnabel zum Ausdruck. Das Ruprechtskraut gehört zu einer Gattung (Geranium), die meistens wohlriechende Arten hervorbringt. Es gibt Geranienarten, die einen Geruch wie Rosen haben. Viele Kosmetikprodukte mit angeblichem Rosenparfüm enthalten in Wirklichkeit das billigere Geraniumöl. Vor diesem Hintergrund hat es eine besondere Bedeutung, dass das Ruprechtskraut einen unharmonischen Geruch verbreitet. Dieser Geruch muss im Zusammenhang mit der Standortwahl gesehen werden. Wenn eine Pflanze atmosphärisch unreine Standorte sucht, bedeutet dies, dass sie die dort herrschende Energie braucht und umsetzt. Der unangenehme Geruch der Pflanze ist ein Zeichen dafür, dass die atmosphärisch energetischen Disharmonien absorbiert und – transformiert auf eine substanzielle Ebene – wieder ausgeschieden werden. Ein weiteres Merkmal der Signatur ist die Rotfärbung der Spitze des Storchenschnabels. Wie alle Vertreter der Familie der Storchenschnabelgewächse hat auch Geranium robertianum eine lange, spitz zulaufende Frucht. Das Besondere an dieser Pflanze ist, dass diese Spitze blutrot überzogen ist und daher die Assoziation mit einer Stichwaffe oder einem Insektenstachel in Aktion zulässt. Hierin kommt das Element des Plötzlichen, des Überraschungsangriffs zum Ausdruck.
Wer Geranium robertianum in seinem Garten hat und auszureissen versucht, wird feststellen, dass dies völlig problemlos ist. Ein leichter Zug, ein kaum spürbarer Widerstand und man hält die ganze Pflanze samt Wurzel in der Hand. Bei näherer Untersuchung stellen wir fest, wie wenig das Ruprechtskraut im Boden verankert ist. Der oberste Teil der Wurzel befindet sich in der Luft. Dann kommt eine dünne, waagrechte Wurzel, die nur wenig unter der Erdoberfläche liegt. Manchmal liegt die Wurzel frei zwischen einer Laubschicht und dem Waldboden, und nur einige Seitenwürzelchen sind mit der Erde verbunden. (Die Pflanze hat keine Pfahlwurzel wie in einigen botanischen Werken angegeben wird.) Doch eine solch schwache Wurzel kann die recht ausladende Pflanze unmöglich halten. Die Wurzel erfüllt denn auch nur die Aufgabe der Wasser- und Mineralsalzversorgung und dient nicht der Halterung der Pflanze. Die Befestigung geschieht auf eine absolut einzigartige Weise. Die Pflanze stützt sich mit umgeformten Blattstielen auf dem Boden ab. Die Stiele bodennaher Blätter machen nach dem Absterben der Blattspreite eine grosse Veränderung durch. Sie beginnen wieder zu wachsen, biegen sich nach unten und an der Spitze wieder etwas nach oben. So bilden die ehemaligen Stiele der unteren Blätter (bei älteren Pflanzen auch der Blätter der Vorjahre) bogenförmige Stützen, auf denen der Storchenschnabel steht. Zieht man die Pflanze leicht nach oben, so heben sich die Stützen vom Boden ab. Die Pflanze ist also nicht fest mit der Erde verbunden, sondern sie setzt sich auf die Erde und kann jederzeit von ihr «abheben».
Als weiteres auffallendes Merkmal müssen die starken knotigen Verdickungen an den Blattanwachsstellen genannt werden. Da dies auch der inneren Wahrnehmung entspricht, ziehe ich hier ausnahmsweise einen Vergleich zwischen diesen Knoten und den Lymphdrüsen. Wie schon im allgemeinen Teil erwähnt, bin ich mit solch direkten Vergleichen zwischen Pflanzen- und Organformen sehr vorsichtig.»
Wesen
«Der Storchschnabel hat eine ziehende, reinigende und entgiftende Wirkung vor allem in Bezug auf Gifte, die unvermittelt und meist durch Fremdeinwirkung in den Körper gelangten, wie zum Beispiel Insektengifte. Analoge «Vergiftungen» gibt es auch auf der seelischen Ebene durch das Erleiden seelischer oder körperlicher Gewaltanwendung oder infolge traumatisierender Erlebnisse wie eines unerwarteten schweren Verlusts. Sie können wie eine Art psychischen Gifts wirken, das eine seelische Lähmung, eine Apathie hervorruft. Bei solchen Zuständen greift Geranium wirkungsvoll ein. Bei akuten Schockzuständen ist mit Geranium innerhalb kürzester Zeit eine Lösung möglich. Auf der körperlichen Ebene besitzt Geranium eine spezifische, aktivierende Wirkung auf den Lymphfluss. Steht ein Mensch durch ein traumatisches Erlebnis unter Schock, sind die feinstofflichen Körper gelockert, sie greifen nicht mehr konzentrisch ineinander. Dies ist die Ursache für den zeitweiligen, mehr oder weniger starken Gedächtnis- und/oder Bewusstseinsverlust. In diesem Zustand der Lockerung ist die Seele ungeschützt geöffnet, so dass fremde Kräfte einwirken können. Auch lange zurückliegende traumatische Erfahrungen können während Jahren eine Blockade auf der psychischen und körperlichen Ebene verursachen, so dass selbst gut gewählte Therapien nicht richtig greifen. Solche Zustände treten immer häufiger auf. Deshalb ist Geranium eine der bedeutendsten Heilpflanzen unserer Zeit. Ihr Wesen bewirkt die Zusammenführung der gelockerten feinstofflichen Körper (Astral- und Ätherkörper) mit dem grobstofflichen Körper; das Bewusstsein greift wieder aktiv ins Leben ein. Geranium entzieht Körper- und Seelengifte und ermöglicht durch diese Reinigung des Terrains einen Neubeginn.»
Botanik
Geranium robertianum L., der Stinkende Storchschnabel, gehört zur Familie der Storchnabelgewächse (Geraniaceae). Diese Art ist verbreitet in krautreichen Wäldern, aber auch in Schluchten, Mauern und Felsen und in Städten treffen wir sie oft an. In Städten begegnet sie uns oft an weniger schönen Plätzen wie Hinterhöfen oder vernachlässigten, schmutzigen Orten. Geranium robertianum ist einjährig oder auch zweijährig. Nach dem Keimen entwickeln sich zunächst Rosettenblätter, die aber meist bald vertrocknen. Die sich dann bildenden und emporwachsenden Sprosse sind bis zu 1 cm dick, sehr saftreich und sparrig verzweigt. Sie zeigen stark verdickte Knoten an denen die Sprosse leicht abbrechen. Der gesamte Spross der Pflanze ist dicht mit länglichen, rötlichen und weichen Drüsenhaaren besetzt. Diese sind für den speziellen herben Geruch verantwortlich, den viele Menschen als unangenehm empfinden. Die zahlreichen Stängelblätter, die sich bilden, stehen gegenständig an den Sprossen. Sie sind aus 3 bis 5 völlig getrennten eiförmigen und bis nahe an den Mittelnerv fiederschnittigen Blättchen zusammengesetzt. Bei starker Sonneneinstrahlung verfärben sich die Blätter und die Sprosse der Pflanze leicht bis stärker rötlich. Geranium robertianum blüht von Mai bis in den Herbst hinein. Die Blüten sind hellpurpurn und relativ klein. Nach der Blüte bilden sich die typischen 2 cm langen Früchte mit ihrer Storchschnabelform und der roten Spitze aus. An einem guten Standort kann Geranium robertianum bis weit über 40 cm hoch werden, es wird eine üppige Masse aus Blättern und Sprossen gebildet. Zieht man an den oberirdischen Teilen, so wird man überrascht feststellen, dass diese sich leicht lösen, sie sind nicht wirklich im Boden verankert. Verwundert wird man dann das kleine Würzelchen betrachten, was sich mit aus dem Boden gelöst hat und sich fragen, wie die Pflanze so aufrecht nach oben wachsen konnte.
Verwendung
Geranium robertianum L. ist unter dem Namen Herba Roberti schon in den Kräuterbüchern des 16. Jahrhunderts zu finden. Die heilige Hildegard von Bingen beschreibt in Ihren Werken einen Storchenschnabel (storchesnabel, storkesnabil) in ihren Werken «Physika» und «Causa et Curae». Er wird zusammen mit anderen Bestandteilen als Universalmittel gegen «Gift und Zaubersprüche», zur Auswurfförderung, Steinleiden, sowie Herzbeschwerden und Traurigkeit eingesetzt. Insgesamt sind sich die Botaniker des späteren Mittelalters über die nützlichen, heilenden Eigenschaften des Storchenschnabels weitestgehend einig. Gemäss traditioneller Anwendungsempfehlungen wird Geranium robertianum L. in der Volksmedizin aufgrund der adstringierenden Eigenschaften vor allem in diesen drei Gebieten angewendet: Blutungen, Durchfall- und Hauterkrankungen. Des Weiteren sind in der homöopathischen Literatur Schock- und Angstzustände, Panik, (Lymphknoten)-Schwellungen und Aktivierung des Lymphflusses zur Entgiftung z.B. nach Zeckenbissen und als Begleitung einer Borreliosetherapie, psychische Lähmungszustände und Melancholie infolge von Schrecken und Traumen als Anwendungsgebiete beschrieben.
Inhaltsstoffe
Das Ruprechtskraut, Geranium robertianum L., erkennt man an seinem sehr charakteristischen, unangenehmen Geruch; daher auch der Beiname Stinkender Storchenschnabel. Dafür verantwortlich ist das ätherische Öl. Des Weiteren findet man phenolische Verbindungen: Pflanzensäuren, Flavonoide und Gerbstoffe. Bemerkenswert ist auch der relativ hohe Gehalt an Vitamin C.
Referenzen
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Hänsel, R., Keller, K., Rimpler, H. & Schneider, G. Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis Band 5 Drogen E-O. (Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1993, 1993).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2018).
- Riha, O. Hildegard von Bingen – Werke – Band II – Ursprung und Behandlung der Krankheiten – Causa et Curae – Vollständig neu übersetzt und eingeleitet. (Beuroner Kunstverlag (Abtei St. Hildegard, Rüdesheim/Eibingen), 2016).
- Riha, O. Hildegard von Bingen – Werke- Band V- Heilsame Schöpfung – Die natürliche Wirkkraft der Dinge – Physica – Vollständig neu übersetzt und eingeleitet. (Beuroner Kunstverlag (Abtei St. Hildegard, Rüdesheim/Eibingen), 2016).
- Vermeulen, F. & Johnston, L. Plants Homeopathic and Medicinal Uses from a Botanical Family Perspective Volume 1-4. (Saltire Books Ltd, Glasgow, Scotland, 2011).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.




SALBEI
Salvia officinalis L.
WESEN: Aufnahmefähigkeit, Empfänglichkeit, Yin
Wesen und Signatur
Signatur
«Es gibt Pflanzen mit einem relativ einfachen, klaren Aufbau, die von der Gestalt her keine grossen Besonderheiten erkennen lassen. Dafür haben sie ein Aroma, das sehr tiefgründig ist und einem das Tor zu ihrem Wesen öffnet. Dazu gehört der Salbei, für dessen Aroma das reichlich enthaltene ätherische Öl verantwortlich ist. Der Geruch von Salbei gehört zu den eher seltenen Aromen, deren Wärmecharakter nicht eindeutig festzulegen ist. Ist er nun wärmend oder kühlend? Er passt sich den verschiedenen Situationen an und kann sowohl wärmen als auch kühlen, was ihm die Kraft verleiht, zwischen zwei Welten zu vermitteln. Der Geruch des Salbeis trägt uns wie durch einen Kanal, der die äusseren Schichten des Seins durchdringt, nach innen. Salbei ist keine Pflanze des Lichts. Er steht ganz im Gegensatz zu den Pflanzen, die eine ausgeprägte Beziehung zum Licht haben, wie zum Beispiel Johanniskraut, Ringelblume, Rosskastanie, Augentrost. Wer den Salbei auf die Zunge nimmt, spürt das Wirken einer Wesenskraft, die nach innen, ins Dunkle zieht. Auf diese Weise schafft der Salbei eine Verbindung zwischen aussen und innen, Licht und Dunkel, oben und unten; er stellt ein Gelichgewicht zwischen den Himmels- und Erdenkräften her. Auf der körperlichen Ebene hat die Pflanze einen Bezug zu den Organen, die Substanzen aufnehmen: zum Rachen und zu den weiblichen Geschlechtsorganen. In der Gestalt des Salbeis sehen wir eine Signatur, die der Geruchswahrnehmung völlig entspricht. Wir finden sehr weiche Blätter, die auf der Unterseite graufilzig behaart sind. Sie haben einen sanften, ruhigen, eher kühlen Farbton, der zwischen Blau- und Graugrün liegt. Die Blätter sind wie in einer empfangenden Geste steil nach oben gerichtet. Das neu gebildete, jeweils oberste Blatt jedes Stängels ist zu Beginn ganz eingerollt und bildet so ein senkrecht stehendes Rohr. Später öffnet sich das Blatt, bleibt aber über die ganze Vegetationszeit halbrohrförmig leicht oben eingerollt. Die Blüten der Salbeiarten haben ein charakteristisches Merkmal. Die Staubblätter sind in der Blütenkrone über einen «Schlagbaummechanismus» beweglich befestigt. Wenn eine Biene oder Hummel die Salbeiblüte aufsucht, bewegen sich die oberen Staubfäden nach unten, die Staubbeutel senken sich auf den Körper des Insekts, und der Pollen wird abgestreift. In diesem Mechanismus erkennen wir eine wesenhafte Verbindung zwischen Aufnehmen und Abgeben. Zum Abschluss sei noch erwähnt, dass der botanische Name Salvia vom lateinischen salvare, retten, kommt. Salbei genoss also schon in alten Zeiten eine hohe Wertschätzung als Heil bringende Arzneipflanze.»
Wesen
«Das Wesen des Salbeis unterstützt die Aufnahmefähigkeit und Empfänglichkeit in seelischer und körperlicher Hinsicht. Es besteht ein Zusammenhang zwischen beiden: Eine Halsentzündung und damit verbundene Schluckbeschwerden können auch der körperliche Ausdruck einer psychischen Verfassung sein, in der man bis oben genug hat und nichts mehr schlucken kann. Die menschliche Entwicklung erfordert immer wieder Offenheit gegenüber neuen Impulsen; Wandlungen, Metamorphosen sollen sich vollziehen. Die Angst vor einer Veränderung des Vertrauten, Sicheren wirkt blockierend. Es entsteht eine starke Abwehr gegenüber neuen Impulsen, der Mensch will unbewusst Neuem keinen Einlass mehr gewähren; Entzündungen des Rachens können die Folge sein. Für die Frau beginnt mit dem Eintritt ins Klimakterium eine Lebensphase, in der eine Neuorientierung stattfindet. Ihre Persönlichkeit will erweitert, neue Interessen und Aufgaben müssen gesucht werden. Dabei ist es wichtig, die Empfänglichkeit für Impulse von innen und außen zu fördern. In dieser Situation verstärkt Salbei durch seine Wesenskräfte die Empfänglichkeit auf der seelischen Ebene, welche die nachlassende körperliche Empfängnisfähigkeit zu kompensieren vermag. Frauen in den Wechseljahren schätzen die schweisshemmende Wirkung des Salbeis bei Hitzewallungen. Während der gebärfähigen Lebensphase wird das Gleichgewicht von Yin und Yang durch die Hormonproduktion aufrechterhalten. Aufgrund der verlangsamten Hormonproduktion verändert sich im Klimakterium das Gleichgewicht von Yin und Yang. So kommt es zeitweilig zu einem Wärme- oder Yang-Überschuss. Salbei kann hier kühlend und ausgleichend einwirken.»
Botanik
Salvia officinalis gehört zur Familie der Lippenblütler und ist ein Halbstrauch der zwischen 20 und 100 cm gross werden kann. Er ist ursprünglich eine typisch mediterrane Pflanze, die in Südeuropa, besonders an dürren Kalkhängen beheimatet ist. Der Salbei verholzt in den unteren Teilen, an seinen aufsteigenden, im oberen Bereich mattgrünen und krautigen Stängeln, sitzen seine länglich-eiförmigen Blätter, die bis 7 cm lang und 2 cm breit werden können. Bisweilen tragen diese ein oder zwei Öhrchen am Grund. Seine Blattfläche erscheint oberseits, durch die stark eingesenkte Nervatur, runzelig, unterseits tritt die Nervatur stark hervor. Beim Zerreiben der Blätter sind diese bitter würzig. Der Salbei blüht von Mai bis Juli mit blauen, violetten, manchmal auch weissen Blüten, die intensiv von Insekten besucht werden Die Pflanze überdauert mit im Sommer gebildeten Erneuerungstrieben den Winter.
Verwendung
Schon im frühen Altertum spielte der Salbei eine bedeutende Rolle als Heilpflanze. Salbei wurde unter anderem von Hippokrates, Paracelsus und Hildegard von Bingen beschrieben und fand schon früh Anwendung bei Fieber und akuten Krankheiten, Koliken und bei übermässigem Schweiss. Der Salbei wird heute noch zur Herstellung von Tinkturen und unterschiedlichen Extrakten verwendet. Basierend auf dem langjährigen Gebrauch wird Salbei in der traditionellen Pflanzenheilkunde für die innerliche und äusserliche Anwendung bei entzündlichen Beschwerden im Mund- und Rachenraum, bei dyspeptischen Beschwerden, sowie vermehrter Schweisssekretion eingesetzt. Entsprechende Zubereitungen aus Salbei werden auch nach dem homöopathischen Arzneibild bei Störungen der Schweissbildung eingesetzt. Salbeiblätter werden auch als Lebensmittel zum Würzen von Speisen oder für Teezubereitungen verwendet. Des Weiteren wird über Wasserdampfdestillation aus Blättern des Salbeis das ätherische Öl gewonnen. Dieses wird zur Herstellung von Parfüms und Mundwässern verwendet.
Inhaltsstoffe
Ein typischer Inhaltsstoff des Salbeis ist das ätherische Öl, welches sich aus Thujon, Campher, Cineol, Pinen, Borneol und einer grossen Zahl von weiteren Nebenstoffen zusammensetzt. Des Weiteren findet man Diterpene, Triterpene, aromatische Verbindungen und Polysaccharide.
Referenzen
- Info Flora. Salvia officinalis L. https://www.infoflora.ch/de/flora/salvia-officinalis.html. Accessed March 25, 2020.
- Hänsel R, Steinegger E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. 10th ed. (Sticher O, Heilmann J, Zünddorf I, eds.). Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland; 2015.
- Madaus G. Madaus Lehrbuch Der Biologischen Heilmittel. mediamed verlag, Ravensburg; 1987.
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). European Union herbal monograph on Salvia officinalis L., folium. EMA/HMPC/277152/2015. 2016.
- BGA/BfArM (Kommission D). Salvia officinalis L. Bundesanzeiger. 1986;108 a. https://buecher.heilpflanzen-welt.de/BGA-Kommission-D-Monographien/salvia-officinalis.htm. Accessed March 24, 2020.
- Kalbermatten R, Kalbermatten H. Pflanzliche Urtinkturen. 7th ed. AT Verlag, Aarau, Schweiz; 2014.
- Kalbermatten R. Wesen Und Signatur Der Heilpflanzen. 9th ed. AT Verlag, Aarau, Schweiz; 2016.
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.




SCHACHTELHALM
Equisetum arvense L.
WESEN: Gliederung, Strukturierung, Klarheit der Gedanken
Wesen und Signatur
Signatur
«Der Ackerschachtelhalm ist eine Pionierpflanze, die Kiesgruben, Schuttplätze und Äcker besiedelt. Im Frühjahr treibt er fertile Sprosse mit den typischen, zapfenförmigen Sporenähren. Im Sommer erscheinen die grünen, quirlig verzweigten, sterilen Sprosse, die bis weit in den Herbst hinein erhalten bleiben. Der Schachtelhalm unterscheidet sich deutlich von anderen Pflanzen. Er besitzt nicht die übliche Gliederung der oberirdischen Teile in Stengel, Blatt und Blüte. Die Blätter sind reduziert auf kleine, den Stengel und die Seitentriebe an den Knoten umfassende Blattscheiden mit dreieckig-lanzettlichen Zähnen. Blüten fehlen ganz. Die Pflanzengestalt ist beschränkt auf Stengel und Seitentriebe. Es finden sich keine in die Fülle oder Breite gehende Formen. Alles ist begrenzt auf das absolut Notwendige, auf das Gerüst, das Skelett. Dieses Pflanzenskelett weist eine durchgehende Gliederung und Strukturierung auf: Stengel und Seitentriebe bestehen aus kleinen, an den Knoten ineinander geschachtelten Abschnitten (daher der Name). Es erscheint, wie wenn die Glieder bei den Blattscheiden ineinander gesteckt wären. Die einzelnen Stengelabschnitte lassen sich leicht auseinander ziehen und wieder zusammenstecken. Die Abschnitte sind hohl und weisen an der Aussenseite hervortretende Längsrippen auf, die der Oberfläche eine klare Struktur verleihen. Die im Frühling erscheinenden Sporangienähren sind geometrisch, ja fast mineralisch strukturiert. Sie weisen eine regelmässige, sechseckige Wabenstruktur auf. Beim Zerkauen von Schachtelhalm knirscht es zwischen den Zähnen, denn in das Grundgerüst der Zellwände ist Kieselsäure eingebaut. Die Pflanze weist einen sehr hohen Kieselsäuregehalt (Siliciumdioxid, Quarz) auf. Die dadurch bedingte Scheuerwirkung wurde früher zur Reinigung von Zinngeschirr (daher auch Zinnkraut) benutzt. Der Kieselsäuregehalt gehört zu den ausgeprägtesten Merkmalen dieser Pflanze. In gewissem Sinne ist der Schachtelhalm Pflanze gewordener Kristall. Die Kieselsäure ist im Innern so dicht und stark vernetzt, dass bei der Verbrennung die ursprüngliche Pflanzengestalt als weisses Aschegerüst erhalten bleibt. Das angedeutete Wesen der Strukturierung, Gliederung und Skelettbildung und der hohe Kieselsäure-(Silicium-)Gehalt wirken im Bindegewebe zusammen und führen zu einer Unterstützung der Knochenbildung. Das Bindegewebe hält nicht nur die Organe, Gefässe und Muskeln zusammen, aus dem Bindegewebe wird auch das Knochengewebe gebildet. Für die Knochenbildung ist Silicium essenziell. Siliciummangel führt zu verzögertem Wachstum und deformierter Knochenbildung. An den Stellen der Knochenneubildung im Bindegewebe reichert sich Silicium an. Es finden sich weitere Beziehungen zum Bindegewebe: Die sich auf das Wesentliche und Gerüsthafte begrenzende Formbildungskraft des Schachtelhalms kommt auf der organischen Ebene in der ödemhemmenden Wirkung zum Ausdruck. Schachtelhalm begrenzt den bei einem Ödem aus der Form geratenen Körperteil wieder auf seine ursprüngliche Dimension. Das Bindegewebe hat eine zentrale Funktion im Stoff- bzw. Informationstransport von den Blutkapillaren und Lymphgefässen bzw. den Nervenenden zu den Zellen und zurück. Die Stoffe und Informationen werden nicht direkt aus dem Kreislaufsystem bzw. dem Nervensystem in die Zellen geleitet, sondern der Austausch erfolgt über die im Bindegewebe gelegene Verbindung. Dies ist auch der Ort, wo im Übermass zugeführte oder im Stoffwechsel entstandene Giftstoffe deponiert werden. Die Ablagerung von Toxinen führt zu einer Behinderung der Transportfunktionen und der Informationsübertragung des Bindegewebes. In der Folge kommt es zu einer Beeinträchtigung der Regulation und weiter zu funktionellen Störungen. Bei einer ganzheitlichen Therapie ist die Reinigung des Bindegewebes demnach ein zentrales Anliegen. Hier bietet sich Schachtelhalm an. Interessant ist auch die Parallele zwischen der Verwendung von Silicium in der Technik bei Informationsübertragungssystemen in der elektronischen Datenverarbeitung und seiner biologischen Bedeutung im Bindegewebe. Auch wenn bisher erst die Funktion von Silicium bei der Knochenbildung bekannt ist, kann man vermuten, dass diesem Element auch bei der Informationsübertragung im Bindegewebe eine entscheidende Bedeutung zukommt.»
Wesen
«Das Wesen des Schachtelhalms ist gekennzeichnet durch die Beschränkung auf das absolut Notwendige, auf das Gerüst, auf die Struktur. Die Pflanze zeigt keine Formen, die in die Fülle gehen. Sie ist sehr reich an strukturierenden Mineralstoffen, insbesondere an Kieselsäure in kristalliner Gestalt. Sie ist gewissermaßen Pflanze gewordenes Mineral. Im Schachtelhalm sind diejenigen Kräfte verkörpert, die für eine klare Gliederung und Strukturierung des Denkens und der Formbildeprozesse erforderlich sind. Demzufolge ist der Schachtelhalm bei all jenen Zuständen angezeigt, in denen die Fähigkeit zur Struktur- oder Formbildung geschwächt ist. Dies äußert sich zum Beispiel in unklarem Denken oder in einem Mangel an Ordnungssinn und Organisationstalent. Der Mangel kann sich aber ebenso im Gegenteil äußern, in der Abhängigkeit von starren Strukturen, Normen und Ordnungen. Hervorzuheben ist auch die stärkende Wirkung des Schachtelhalms auf das Bindegewebe und das Skelett (insbesondere die Wirbelsäule), also auf diejenigen Systeme, die unseren Körper strukturieren.»
Botanik
Der Schachtelhalm, Equisetum arvense L., ist ein lebendes Fossil. Mindestens seit 150 Millionen Jahren gibt es Schachtelhalme, die unserer heutigen Art stark gleichen. Somit könnte es sich bei diesen um eine der ältesten, wenn nicht sogar um die älteste noch heute vorkommende Pflanzengattung handeln. Der Schachtelhalm überwintert mit seinen sehr tief in den Erdboden vorstoßenden Rhizomen unter der Erde. Im Frühjahr treibt er zunächst seine hellbraunen und fruchtbaren Sporentriebe mit ihren fast mineralisch anmutenden Sporenträgern aus. Diese verbreiten die Sporen, denn der Schachtelhalm gehört zu den Farnen. Hiernach treiben die typischen grünen vegetativen Triebe aus, welche bis zum Spätherbst erhalten bleiben und bis 50 cm hoch werden können. Dem Schachtelhalm fehlt die typische pflanzliche Gliederung in Stängel, Blatt und Blüte. Er wirkt effizient, klar gegliedert, strukturiert und geordnet, nichts an ihm ist Verschwendung, er wirkt dadurch gar nicht wie eine «gewöhnliche» Pflanze. Die Blätter des Schachtelhalms etwa, sind extrem reduziert und liegen als Scheide direkt dem Trieb an, wirtelig stehen viele Seitenäste vom Trieb ab. Der ganze Trieb ist in deutliche Abschnitte gegliedert, man kann diesen einfach auseinanderziehen. Berührt man die Pflanze, so wird man überrascht von der Festigkeit und der Struktur, die man wahrnimmt. Die Pflanze erhält diese durch Kieselsäureeinlagerungen, die in dieser Gattung besonders stark vertreten sind.
Verwendung
Der Schachtelhalm, Equisetum arvense L., blickt auf eine sehr lange naturheilkundliche Anwendungstradition zurück. Schon der Kräuterpfarrer Sebastian Kneipp lobt die vielseitigen Wirkungen dieses Heilkrautes. Während in der Vergangenheit vielfach Tees und auch äußere Anwendungen, wie Sitzbäder, üblich waren, haben sich heutzutage eher orale Einnahmeformen durchgesetzt: Frischpflanzenpresssaft, Flüssig- und Trockenextrakte und Tinkturen. Das Hauptanwendungsgebiet liegt in verschiedenen Therapierichtungen im Bereich der Nieren- und Harnwegserkrankungen. Die diuretischen Eigenschaften arzneilicher Zubereitungen aus Equisetum arvense L. können zur begleitenden Behandlung unkomplizierter Harnwegsinfektionen, bei Ödemen und zur Vorbeugung von Nierengrieß (Lithiasis) sinnvoll sein. Des Weiteren sind Gelenks- und Hautbeschwerden als Anwendungsgebiete in der Literatur erwähnt.
Inhaltsstoffe
Der Schachtelhalm enthält typischerweise Mineralische Bestandteile (ca. 10%), von denen ca. 2/3 auf Kieselsäure entfallen. Daneben finden sich vor allem Kaliumsalze. Zu den weiteren Inhaltsstoffen gehören Flavonoide, wie Quercetin- und Kämpferolglykoside.
Referenzen
- Wichtl, M. et al. Teedrogen und Phytopharmaka. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 1997).
- BGA/BfArM (Kommission E). Monographie: Equiseti berba (Schachtelhalmkraut). Bundesanzeiger 173, (1986).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment report on Equisetum arvense L., herba. EMA/HMPC/278089/2015 (2016).
- BGA/BfArM (Kommission D). Equisetum arvense. Bundesanzeiger 109 a, (1987).
- Dragos, D. et al. Phytomedicine in joint disorders. Nutrients 9, (2017).
- Gilca, M., Tiplica, G. S. & Salavastru, C. M. Traditional and ethnobotanical dermatology practices in Romania and other Eastern European countries. Clin Dermatol. 36, 338–352 (2018).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil.




SCHAFGARBE
Achillea millefolium L.
WESEN: Unterscheidungsvermögen, Erkenntnis des Wesentlichen
Wesen und Signatur
Signatur
«Die Schafgarbe hat bei Heilpflanzenkundigen oft Befremden ausgelöst, da sie sich nicht eindeutig festlegen lässt. So kann die Schafgarbe sowohl Nasenbluten stillen als auch erzeugen, oder sie kann sowohl Krämpfe lösen als auch verursachen. Gerade im westlichen Kulturkreis, wo man sich mit der Polarität allen Seins oft schwer tut und eindeutige Verhältnisse anstrebt, fällt es nicht leicht, die wahre Grösse der Schafgarbe zu erfassen. Die Polarisierung ist in der Signatur der Schafgarbe deutlich erkennbar. Um dies nachvollziehen zu können, müssen wir uns mit dem Bauprinzip der Korbblütler beschäftigen, zu denen die Schafgarbe gehört. Die Korbblütler haben, wie der Name sagt, komplexe, zu Körben zusammengefasste Blütenstände. Die Sonnenblume beispielsweise ist keine einzelne Blüte, sondern ein Blütenstand, bestehend aus Hunderten von Blüten. Jedes gelbe Blütenblatt an der Peripherie oder jeder Sonnenblumenkern im Inneren des Blütenstandes stammt aus einer anderen Blüte. Der Blütenstand wird äusserlich zusammengehalten von einem gemeinsamen Blütenboden und einer Hülle aus meist grünen Hüllblättern.
Bei oberflächlicher Betrachtung der Schafgarbe könnte man meinen, einen Vertreter aus der Familie der Doldengewächse vor sich zu haben. Die einzelnen «Blüten» bilden einen doldenförmigen Blütenstand. Für Korbblütler ist es einzigartig, dass die an und für sich schon komplexen Blütenstände – die Körbchen – nochmals zu einem doldigen Gesamtkomplex zusammengefasst werden. Im Gegensatz zu den Doldengewächsen ist der Blütenstand bei der Schafgarbe aber nicht regenschirmartig gewölbt, sondern ziemlich abgeflacht, so dass die Pflanze beim Anblick von der Seite wie ein grosses T aussieht. Wir stellen fest, dass die Blütenstände (Körbchen), vollständig dem Bereich von Stengel und Blatt entzogen, zu einer Ebene am Ende der Pflanze erhoben sind. Wir finden somit nicht die für die Pflanzenfamilie typische, harmonische Eingliederung der Blütenstände in die Gesamtpflanze, sondern eine Trennung, eine Polarisierung in einen Stengel- und Blattbereich einerseits und einen Blütenbereich andererseits. Der Charakter der Trennung wird vor allem auch durch die Tatsache verstärkt, dass der Blütenstand eine Ebene bildet, die wie auf dem Stengel aufgesetzt erscheint. Die Blütenfarbe ist meistens weiss, doch gibt es in der Natur immer auch Exemplare mit rosa Blüten. Es handelt sich dabei nicht um eine andere Art, sondern zeigt, dass die Schafgarbe nicht auf eine spezifische Farbe festgelegt ist. Gehen wir weiter und betrachten den Stengel und die Blätter, so finden wir, dass beides optisch nicht zusammenpasst. Die hellgrünen Stengel sind grob und hölzern – lässt man getrocknete Stengelstücke auf einen Tisch fallen, ertönt ein klackendes Geräusch (im chinesischen I Ging werden Schafgarbenstengel verwendet) –, während die Blätter sehr weich, blaugrün und äusserst fein zweifach fiederteilig sind. Bei der Schafgarbe findet man nicht das sonst übliche harmonische Zusammenspiel zwischen Stengel und Blättern, bei dem sich die Blätter nach und nach aus dem Stengel entwickeln. Die Blätter wirken wie aufgesetzt und dem Stengel fremd. Beschäftigen wir uns näher mit den Blättern, die für die Art namensgebend sind. «Millefolium» bedeutet tausend Blätter und nimmt Bezug auf die vielfache Teilung der einzelnen Blätter. Obwohl es nicht gerade tausend Blattteile sind, ist das Ausmass der Differenzierung eines Schafgarbenblatts aussergewöhnlich. Die Differenziertheit geht immer einher mit der Unterscheidung der Gegensätze. Je mehr gegensätzliche Aspekte einer Sache wir bewusst wahrnehmen, desto differenzierter und wahrer ist unsere Erkenntnis. Insofern sind Polarisierung und Differenzierung sich zyklisch wiederholende Stufen im Erkenntnisprozess. Beides finden wir in der Schafgarbe. Auch bei Duft und Aroma können wir zwei gegensätzliche Komponenten wahrnehmen. Die Schafgarbe schmeckt einerseits bitter und wirkt damit zusammenziehend, konkretisierend, und andererseits hat sie ein typisches – nicht allzu starkes – Aroma, das ich am ehesten mit schwebend umschreiben möchte. Immer wenn ich die Schafgarbe teste, habe ich den Eindruck, dass ein Teil des Aromas hinweg in ferne Welten führen möchte, während der andere Teil sehr konkret auf das Hier und Jetzt gerichtet ist. Etwas vom Wesentlichsten bei der Schafgarbe ist ihr besonderes Leuchten. Betrachte ich blühende Schafgarben am schattigen Waldrand, so glaube ich ein sanftes Leuchten ihrer Blüten wahrzunehmen. Da die Blüten äusserlich, physikalisch kein Licht ausstrahlen, handelt es sich dabei um die intuitive Wahrnehmung eines ätherischen Lichts. Es ist gewissermassen ein Licht der Natur, um die Polaritäten zu erkennen. Es gibt ein deutliches Zeichen für dieses innere Leuchten in der äusseren Gestalt. Bei den Schafgarbenblüten sind, im Gegensatz zu anderen Korbblütern, auch die inneren Röhrenblüten weiss gefärbt wie die randständigen Zungenblüten. Da die Körbchen, wie oben erwähnt, sehr dicht zusammen stehen, wirkt der Blütenstand wie einedurchgehend weisse (oder rosa) Fläche. Somit erscheint der Blütenstand viel heller, er reflektiert mehr Licht, als es bei einer «normalen» Blütenfärbung der Fall wäre.»
Wesen
«Die Schafgarbe symbolisiert das Vermögen, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Dazu müssen nicht nur die gegensätzlichen Aspekte einer Sache erkannt sondern auch ihr Zusammenhang gesehen werden. Nur wenn in der Widersprüchlichkeit der Tatsachen, Erfahrungen und Aufgaben der gemeinsame Kern erkannt wird, der die Vielfalt zu einem Ganzen verbindet, gelingt es, die Prioritäten richtig zu setzen. Ohne diese Fähigkeit besteht die Tendenz zu polarisieren und dabei von einem Extrem ins andere zu fallen. Die Schafgarbe steht für das Vermögen, aus den polaren Aspekten des Lebens die richtige Einsicht zu erlangen, die zur Integration der Gegensätze führt. So schärft sie das Unterscheidungsvermögen bei den Entscheidungsprozessen und kann auf diese Weise bei der persönlichen, richtigen Wahl des nächsten Schrittes klärend und unterstützend wirken. Die Pflanze unterstützt sowohl den Menschen mit einem schwachen Unterscheidungsvermögen als auch denjenigen, der immer rasch und sehr entschieden zu einer bestimmten Meinung (Vorurteil) gelangt oder schnell heftige Kritik übt. Denn beides ist ein Zeichen dafür, dass es der inneren Einsichtsfähigkeit am nötigen Licht fehlt, das über die Widersprüchlichkeit der Polarität hinaus führt. Auf der körperlichen Ebene kann sich dieser Mangel u.a. dadurch äußern, dass gewissen Beschwerden keine eindeutigen Auslöser zugrunde liegen: So kann ein bestimmtes Nahrungsmittel einmal eine Magenkrise auslösen und ein anderes Mal problemlos vertragen werden.»
Botanik
Achillea millefolium L., die Gewöhnliche Schafgarbe, ist eine ausdauernde Pflanze mit einem aromatischen Duft. Zunächst bildet sie rosettenartig angeordnete Blätter. Ihre sich später entwickelnden Stängel sind sehr fest und tragen ebenfalls Blätter. Alle Blätter der Pflanze sind tief fiederschnittig und dadurch stark differenziert. Dies kommt auch im Namen «millefolium», tausendblättrig, zum Ausdruck. Die Blätter sind sehr fein und weich, ganz im Gegensatz zum fast hölzernen Stängel. Ab etwa Juli beginnt die Pflanze mit ihrer Blüte. Weit oben an der Spitze der Schafgarbe, stehen die meist weissen, gelegentlich auch rosafarbenen Blüten in schirmförmigen Blütenständen zusammen. Auf den ersten Blick könnte man die Pflanze aufgrund des Blütenstandes, für einen Vertreter der Doldenblütler halten. Betrachtet man den Blütenstand aber genauer, so fällt auf, dass die Schafgarbe zu den Korbblütlern gehört. Die Vertreter dieser Familie nehmen die Einzelblüten bereits zu schönen Blütenständen, den Korbblüten, zusammen, wie wir es etwa von dem Sonnenhut oder dem Löwenzahn kennen. Doch die Schafgarbe fasst hierüber hinaus diese Korbblüten nochmals zusammen und bildet somit mit ihren schirmförmigen Blütenständen eine Art zusätzliche Ebene aus.
Verwendung
Die Schafgarbe, Achillea millefolium L., ist bereits im Arzneischatz der heiligen Hildegard von Bingen enthalten, die sie innerlich und äusserlich bei Wunden, sowie bei Beschwerden der Augen und Dreitagefieber einsetzte. Die Anwendungsgebiete sind sowohl in der traditionellen als auch in der neueren Literatur der verschiedenen Therapierichtungen, zahlreich und überschneidend. Ein Schwerpunkt liegt in der Pflanzenheilkunde im Bereich gastrointestinaler Beschwerden, wo Achillea millefolium L. durch ihre spasmolytischen und choleretischen Wirkungen helfen kann. Interessanterweise finden wir in der Fachliteratur den Hinweis, dass die Schafgarbe als Ersatz für die Kamille genutzt werden kann, da die Anwendungsgebiete beider Heilpflanzen so große Überschneidungen aufweisen. Die Homöopathie setzt die Schafgarbe unter anderem bei Wunden und Blutungen ein. Insgesamt kann die Schafgarbe als blutstillendes Mittel angesehen werden, wobei Ihr Einsatz insbesondere bei hellroten Blutungen der Lungen, des Darms, der Gebärmutter, der Blase und der Nase erfolgt. Ein weiteres Anwendungsgebiet der Schafgarbe liegt im Bereich der Frauenheilkunde: krampfartige Menstruationsbeschwerden und andere typische Beschwerdebilder können unterstützend behandelt werden.
Inhaltsstoffe
Im ätherischen Öl der Schafgarbe, Achillea millefolium L., konnten über 100 Einzelbestandteile identifiziert werden. Daneben finden sich z. T. bittere Sesquiterpenlactone, insbesondere Guajanolide. Weitere Inhaltsstoffgruppen sind Polyacetylene, Flavonoide und Phenolcarbonsäuren. Der Gehalt an Proazulen schwankt je nach Unterart und wird in manchen Arzneibüchern als Qualitätskriterium für diese Arzneipflanze definiert.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- Wichtl, M. et al. Teedrogen und Phytopharmaka. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 1997).
- BGA/BfArM (Kommission E). Achillea millefolium (Schafgarbe). Bundesanzeiger 22a, (1990).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- BGA/BfArM (Kommission D). Achillea millefolium. Bundesanzeiger 29 a, (1986).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Community herbal monograph on Achillea millefolium L., flos. EMA/HMPC/143949/2010 (2011).
- Riha, O. Hildegard von Bingen – Werke- Band V- Heilsame Schöpfung – Die natürliche Wirkkraft der Dinge – Physica – Vollständig neu übersetzt und eingeleitet. (Beuroner Kunstverlag (Abtei St. Hildegard, Rüdesheim/Eibingen), 2016).
- Kalbermatten R, Kalbermatten H. Pflanzliche Urtinkturen. 7th ed. AT Verlag, Aarau, Schweiz; 2014.
- Kalbermatten R. Wesen Und Signatur Der Heilpflanzen. 9th ed. AT Verlag, Aarau, Schweiz; 2016.
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil




SCHWARZE JOHANNISBEERE
Ribes nigrum L.
WESEN: Einheit, Symbiose, Abweisung von Widersprüchen
Wesen und Signatur
Signatur
«Bei der Schwarzen Johannisbeere fällt auf, wie wenig sie polarisiert und differenziert ist. Dies kommt darin zum Ausdruck, dass Blätter, Blütenknospen, Blüten, Früchte und Rinde einen identischen Geruch aufweisen. Der Geruch wird bestimmt durch das ätherische Öl, das in den genannten Pflanzenteilen zu finden ist. Nun wird aber dieses Öl nicht – wie bei den meisten Pflanzen – in den Zellen der Pflanzenteile gebildet und gelagert, sondern in so genannten Drüsenhaaren, die die Oberfläche der Pflanze mehr oder weniger dicht bedecken. An den Blättern erscheinen die Drüsenhaare nur auf der Unterseite. Dies kann man einfach testen: Nur wenn man an der Unterseite der Blätter reibt, entwickelt sich das typische Aroma. Wir können aus dieser Verteilung der Aromastoffe folgern, dass das Wesen der Schwarzen Johannisbeere etwas auf der Oberfläche Verbindendes hat? Interessant ist, dass die Menschen auf das Aroma gegensätzlich reagieren. Der Geruch wird von vielen als sehr angenehm und harmonisch empfunden, von anderen aber als widerlich und abstossend. Weil manche Menschen den Geruch mit demjenigen stinkender Wanzen in Verbindung bringen, heisst der Strauch im Volksmund auch Wanzenstrauch. Bei der Herstellung der wesenhaften Urtinktur aus Ribes nigrum L. lässt sich feststellen, dass diese Pflanze ganz andere Eigenschaften als die anderen hat. Nach dem Mahl- und Dynamisierungsprozess in der Mörsermühle werden die Ansätze in Steinzeugtöpfe gegeben, wo sie etwa 10 Tage bleiben und jeden Tag gerührt werden. Beim Rühren mit einem Holzspatel kann man die Eigenschaften der jeweiligen Pflanzen gut erkennen. Der Normalfall ist, dass die gemahlenen Pflanzenteile miteinander eine Verbindung eingehen, einen zusammenhängenden Brei bilden. Bei der Schwarzen Johannisbeere hingegen spürt man, wie die einzelnen Blattteile völlig verbindungslos sind und wie Schichten aneinander abgleiten. In dieser Eigenschaft kann man erkennen, dass die Ablehnung der Polarität nicht zu einer Einheit führen kann. Eine echte Verbindung entsteht durch das Annehmen von Gegensätzen. Aufgrund dieser Wesenszüge werden die Blätter der Schwarzen Johannisbeere selten als Einzelmittel gebraucht. Ihre wirklichen Qualitäten kommen erst dann zum Ausdruck, wenn sie zusammen mit einem anderen, in die gleiche Richtung wirkenden pflanzlichen Mittel kombiniert werden.»
Wesen
«Das Wesen von Ribes nigrum L. symbolisiert das Verlangen nach einer symbiotischen Einheit mit Gleichgesinnten, in der Widersprüche und Gegensätze nicht akzeptiert werden können. Der Ribes-nigrum-Typ leidet unter der Polarität und Widersprüchlichkeit des Lebens und sehnt sich nach bedingungsloser Liebe. In der positiven Gestalt dieses Wesens erkennen wir Charaktereigenschaften wie die Neigung zum Bewahren, mütterliches Umfangen, Hingabe, wohltuende Freigiebigkeit. In der übersteigerten, negativen Form sehen wir Habgier, Eigenliebe sowie vereinnahmende Tendenzen. Die Wesenskräfte der Schwarzen Johannisbeere unterstützen Menschen mit dem beschriebenen Bedürfnis nach Einheit und Verschmelzung in den schmerzlichen Erfahrungen, die sich aus der Begegnung mit Widersprüchen und Gegensätzen zwangsläufig ergeben. Wie alle Nierenpflanzen repräsentiert Ribes nigrum L. die aktive, bewusste Hinwendung zum Mitmenschen. Die Einnahme dieser Pflanze kann das Bewusstsein dafür schärfen, dass alle Menschen miteinander verbunden sind und nur in der Gemeinschaft wirkliches Menschsein möglich ist. Vereinnahmendes, verletzendes Verhalten, das diesem Grundgesetz widerstrebt, kann besser erkannt werden.»
Botanik
«Das Wesen von Ribes nigrum L. symbolisiert das Verlangen nach einer symbiotischen Einheit mit Gleichgesinnten, in der Widersprüche und Gegensätze nicht akzeptiert werden können. Der Ribes-nigrum-Typ leidet unter der Polarität und Widersprüchlichkeit des Lebens und sehnt sich nach bedingungsloser Liebe. In der positiven Gestalt dieses Wesens erkennen wir Charaktereigenschaften wie die Neigung zum Bewahren, mütterliches Umfangen, Hingabe, wohltuende Freigiebigkeit. In der übersteigerten, negativen Form sehen wir Habgier, Eigenliebe sowie vereinnahmende Tendenzen. Die Wesenskräfte der Schwarzen Johannisbeere unterstützen Menschen mit dem beschriebenen Bedürfnis nach Einheit und Verschmelzung in den schmerzlichen Erfahrungen, die sich aus der Begegnung mit Widersprüchen und Gegensätzen zwangsläufig ergeben. Wie alle Nierenpflanzen repräsentiert Ribes nigrum L. die aktive, bewusste Hinwendung zum Mitmenschen. Die Einnahme dieser Pflanze kann das Bewusstsein dafür schärfen, dass alle Menschen miteinander verbunden sind und nur in der Gemeinschaft wirkliches Menschsein möglich ist. Vereinnahmendes, verletzendes Verhalten, das diesem Grundgesetz widerstrebt, kann besser erkannt werden.»
Verwendung
In der Volksmedizin wurden Blätter von Beerensträuchern für viele verschiedene Beschwerden genutzt. Zum Beispiel wurden die Blätter zur Wundheilung lokal auf Wunden oder bei Migräne auf dem Kopf aufgelegt. Den Blättern der schwarzen Johannisbeere wird eine diuretische und entzündungshemmende Wirkung zugeschrieben. Innerlich wird die Pflanze zur Erhöhung der Harnmenge, sowie unterstützend bei Arthritis, Rheuma und Gicht angewendet. Die unterstützende Behandlung bei rheumatischen und leichten Harnwegsbeschwerden hat sich bis heute in der Pflanzenheilkunde etabliert. Die schwarze Johannisbeere ist besonders auch in der Gemmotherapie als «pflanzliches Kortison» eines der gebräuchlichsten entzündungshemmenden Mittel.
Inhaltsstoffe
Charakteristische Inhaltsstoffe sind Flavonoide, Zimtsäurederivate und ätherisches Öl.
Referenzen
- European Scientific Cooperative On Phytotherapy (ESCOP). ESCOP Monographs. (Georg Thieme Verlag, Rüdigerstrasse 14, D-70469 Stuttgart, Germany and Thieme New York, 333 Seventh Avenue, New York NY 10001, USA, 2003).
- Hänsel, R., Keller, K., Rimpler, H. & Schneider, G. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis Band 5 Drogen P-Z. (Springer Verlag Berlin Heidelberg, 1994).
- Wichtl, M. et al. Teedrogen und Phytopharmaka. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 1997).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment Report on Ribes nigrum L. folium. EMA/HMPC/745347/2016 (2017).
- Roth, C. Gemmotherapie – Die Knospenmedizin. Dtsch. Heilpraktiker Zeitschrift 3, 18–21 (2013).
- Staszowska-Karkut, M. & Materska, M. Phenolic composition, mineral content, and beneficial bioactivities of leaf extracts from black currant (Ribes nigrum l.), raspberry (rubus idaeus), and aronia (aronia melanocarpa). Nutrients 12, 14 (2020).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2018).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil




SONNENHUT
Echinacea purpurea (L.) MOENCH
WESEN: Abschirmung, Eingrenzung, Schutzhaut
Wesen und Signatur
Signatur
«Das Blütenköpfchen des Sonnenhuts besitzt zur Mitte hin einen charakteristisch nach oben gewölbten Blütenboden. Ausserdem ist der braune, gewölbte Innenteil des Köpfchens mit stacheligen Borsten versehen, was ihm die Form und den Charakter eines Igels in der Abwehrhaltung verleiht. Dieses Merkmal gab der Gattung den botanischen Namen Echinacea (von griechisch echinos, Igel). Auch die englische Bezeichnung «Cone Flower» verweist auf den konisch gewölbten Blütenboden, ebenso wie der deutsche Namen «Sonnenhut» die einem Sombrero ähnliche Form der Blüte im mittleren Blühstadium beschreibt (siehe unten). Die randständigen purpurnen Strahlenblüten vollziehen im Verlauf der Blütenentwicklung eine Bewegung um 180 Grad. Zu Beginn, bei der gerade aufgehenden Blüte, stehen sie senkrecht nach oben, sind noch schmal zusammengerollt, kurz und kaum gefärbt. Zu diesem Zeitpunkt ist der Blütenboden noch nicht gewölbt. Später neigen sich die Strahlenblüten in die Horizontale und erreichen die volle Grösse und Farbe. In diesem Stadium beginnt sich der Blütenboden nach oben zu wölben und wird immer stacheliger. Jetzt hat der Blütenkopf die Form eines Sombreros. Daraufhin beginnen sich die Strahlenblüten nach unten zu neigen, bis sie bei der vollen Blüte senkrecht nach unten stehen und sowohl den Kelch als auch den Blütenstiel beschirmen. Bemerkenswert ist, dass sich der Blütenkelch durch diese Geste der Strahlenblüten vor den Blicken verbirgt. Der Kelch ist das Äusserste oder die Haut einer Blüte, weil er am Beginn einer Blütenexistenz die Hülle der Knospe bildet. Mit den strahlenden, purpurfarbenen Kronblättern und der hochgewölbten Mitte der Blütenköpfchen ist der Sonnenhut eine schöne, stolze Blume. Ihr Duft ist leicht, unaufdringlich und dabei sehr differenziert und edel. Fernab von jeder Schwere oder Süsslichkeit vermittelt dieser Duft etwas Abgehobenes. Der beim Anblick und Riechen erahnte Charakter der Unnahbarkeit bestätigt sich bei der Berührung. Neben der igeligen Borstigkeit des Blütenbodens drückt sie sich in der rauhhaarigen, kratzenden Oberfläche von Blättern und Stengel aus, die man der wohlgestalteten Pflanze zwar nicht ansieht, bei Berührung aber deutlich bemerkt. Auch dieses Merkmal unterstreicht eine Pflanzenpersönlichkeit, die auf Abschirmung bedacht ist und nichts an sich herankommen lässt. Zerkaut man ein Wurzelstück, eine Blüte oder ein Blatt der Pflanze, oder nimmt man einige Tropfen der Urtinktur direkt auf die Zunge, bemerkt man einen etwas scharfen Geschmack, der ein pelziges Gefühl und eine leicht anästhesierende Wirkung hinterlässt. Es handelt sich dabei um die Wirkung der Isobutylamide, einer Klasse von Inhaltsstoffen, die in allen Pflanzenteilen in unterschiedlicher Konzentration vorkommt. Abschirmung und Unnahbarkeit sind die Wesensmerkmale, die wir in den Gestaltungskräften der Pflanze erkennen können. Ein solcher Charakter lässt sich unschwer mit der bekannten Stärkung des körpereigenen Abwehrsystems durch Echinacea-Extrakte in Verbindung bringen. Das Immunsystem ist der biologische Abwehrmechanismus, der die Krankheitserreger am Eindringen, der Vermehrung und Ausbreitung hindert. Das Funktionsprinzip des Immunsystems heisst also Abschirmung, damit uns die pathogenen Mikroorganismen nicht zu nahe kommen. In diesem Bereich entfaltet Echinacea auch ihre psychische Wirksamkeit. Ihre auf Abschirmung und Unnahbarkeit ausgerichtete Wesenskraft unterstützt unsere Seele darin, belanglose Angriffe und Reizsituationen an uns abfliessen oder abprallen zu lassen. Das Wesen von Echinacea verleiht uns in gewissem Sinne eine Schutzhaut, ein Panzerhemd oder eine Ritterrüstung und hält dadurch alle Pfeile von uns fern. Sie hilft uns, das Unwesentliche übersehen zu können, nicht wahrzunehmen, zu übergehen. Genauso wie das Immunsystem andauernd unzählige Erreger ohne unsere bewusste Mitwirkung von uns fernhält, ignoriert die lebenstüchtige Psyche die seelischen Erregersituationen, die für uns im Moment nicht aktuell sind. Dabei wirkt Echinacea unterstützend.»
Wesen
«Es ist das Wesen von Echinacea, uns mit einer Schutzhaut, einem Schild zu beschirmen, an dem potenzielle Konfliktauslöser abprallen. Infektionskrankheiten entstehen aus dem Zusammenspiel der drei Faktoren: Erreger, körperliche Abwehr (Immunsystem, Milieu) und psychische Abwehr. Da Erreger immer vorhanden sind, ohne dass es deshalb zu einer Infektion kommen muss, liegt der Schlüssel bei der Abwehr. Die Bedeutung des Immunsystems und des Milieus ist allgemein bekannt, doch die psychische Beeinflussung des Immunsystems ist nicht zu unterschätzen. Eine Abwehrschwäche wird oft durch eine Konfliktsituation ausgelöst. Dabei ist es wichtig, zwischen schwächenden und stärkenden Konflikten zu unterscheiden. Konflikte sind dann stärkend und müssen durchlebt werden, wenn sie zu einem Bewusstwerdungsprozess beitragen, wenn es zum Beispiel um die Abgrenzung gegenüber psychischer Ausbeutung geht. Sie sind aber schwächend, wenn ihnen ein nichtiger Anlass zugrunde liegt, wenn man sich ereifert, ärgert oder streitet über Dinge, die einen entweder nichts angehen oder die so unbedeutend sind, dass sie besser ignoriert würden. Oft entzünden sich Konflikte in Stresssituationen (Überlastung mit Arbeit und Problemen, Schlafmangel, nasskaltes Wetter). Dann kann der geringste Anlass zum Auslöser werden. Daher ist es notwendig, eine psychische Immunität gegenüber den vielen kleinen Unvollkommenheiten des Lebens zu entwickeln, sie zu ignorieren. Dabei unterstützt uns die Wesenskraft des Sonnenhuts. Echinacea umhüllt uns sozusagen mit einer Schutzhaut, die uns abschirmt und dasjenige zusammenhält, was sonst in die Trennung und damit in den Konflikt fallen würde.»
Botanik
Echinacea purpurea (L.) MOENCH, der rote Sonnenhut, ist eine ausdauernde Staude, die aus Nordamerika stammt. Die Pflanze erreicht mit einer Höhe von bis zu 1.80 m eine imposante Grösse. Ihre Blätter sind unten breit-eiförmig und werden nach oben zur Blüte hin eher breit-lanzettlich in der Form. Der Stängel ist nur leicht, die Blätter aber deutlich mit Borstenhaaren besetzt, was der Pflanze eine eher raue und kratzende Ausstrahlung verleiht. Dies scheint so gar nicht zu dem Bild der grossen ausdrucksstarken Korbblüten zu passen, die an der Spitze der Stängel stehen und in den Monaten Juni bis August erscheinen. Diese sind von den wunderbar rosaroten bis purpur farbenen Zungenblüten geprägt. Zu Beginn der Blütezeit stehen die noch grünen Zungenblüten zunächst senkrecht nach oben, im Laufe der Entwicklung erhalten sie die schöne Färbung und klappen dann um 180 Grad nach unten. Die Röhrenblüten, welche in der Mitte der Korbblüte stehen, werden von harten Spreublättern begleitet, die sich wie ein Igel anfühlen und dem Sonnenhut auch den Namen «Igelkopf» gegeben haben. Auch der lateinische Name «Echinacea» leitet sich vom griechischen Wort für Igel (echinos) ab. Im Laufe der Blühphase wölbt sich der zentrale Teil der Blüte immer weiter wie ein Kegel auf, was dieser ihre charakteristische Form gibt. In blühenden Beständen herrscht ein intensiver Besuch von zahlreichen Insekten, die als Bestäuber fungieren.
Verwendung
Die ursprünglich aus Amerika stammende Heilpflanze Echinacea purpurea (L.) MOENCH hat eine lange Tradition in der indianischen Medizin. Es verwundert deshalb nicht, dass die Anwendung von Echinacea-Präparaten schnell einen festen Platz bei den homöopathischen Ärzten in den USA erlangte. Die Echinacea-Pflanze fand schließlich ihren Weg nach Europa, wo sie heutzutage in großen Mengen für die Herstellung von Arzneimitteln kultiviert wird. Die Darreichungsformen sind vielfältig und reichen von Frischpflanzenpresssäften, Extrakten hin zu phytotherapeutischen und homöopathischen Tinkturen. Erkältungskrankheiten sind das Hauptanwendungsgebiet von Echinacea. In der Pflanzenheilkunde wird Echinacea für die Vorbeugung und Behandlung von Erkältungen verwendet. Dies gilt als gut dokumentiertes, gesichertes Anwendungsgebiet. Auch homöopathisch wird Echinacea purpurea (L.) MOENCH unterstützend bei schweren und fieberhaften Infektionen verwendet.
Inhaltsstoffe
Zu den typischen Inhaltsstoffen des roten Sonnenhuts gehören Kaffeesäurederivate (z.B. Cichoriensäure), Flavonoide, ätherisches Öl, Polyacetylene, Alkamide und Polysaccharide.
Referenzen
- Hänsel, R., Keller, K., Rimpler, H. & Schneider, G. Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis Band 5 Drogen E-O. (Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1993, 1993).
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment report on Echinacea purpurea (L.) Moench., radix. EMA/HMPC/424584 (2016).
- BGA/BfArM (Kommission D). Echinacea purpurea. Bundesanzeiger 213, (1989).
- BGA/BfArM (Kommission E). Echinaceae purpureae herba (Purpursonnenhutkraut). Bundesanzeiger 43, (1989).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil




SPITZWEGERICH
Plantago lanceoalata L.
WESEN: Löschen, befeuchten, kühlen
Wesen und Signatur
Signatur
«Der Spitzwegerich hat – wie der botanische Artname lanceolata sagt – lanzettliche Blätter, die durch fünf bis sieben parallele, auf der Unterseite stark hervortretende Blattnerven längs gegliedert sind. Die Blätter bilden eine bodenständige Rosette. Die Nerven sind zäh und können aus einem angerissenen Blatt wie Fäden teilweise herausgezogen werden.
Wenn man das Blatt mit seinen Längsrippen betrachtet, fällt die Ähnlichkeit mit einem freigelegten Muskelstrang auf. Oberflächlich gesehen könnte man davon eine Wirkung auf die Muskeln ableiten, was aber nicht zutrifft. Die wahre Bedeutung dieses Zeichens kann nur verstanden werden, wenn man den Spitzwegerich nicht mit dem Muskel an sich, sondern mit dessen Wesen in Verbindung bringt. Die Muskeln ermöglichen Tier und Mensch die Fortbewegung und erheben sie über die Standortgebundenheit der Pflanzen. Sie erlauben die aktiven Bewegungen innerhalb des Körpers, wie die Atmung, den Herzschlag, die Darmperistaltik. Die Muskeln sind die Instrumente der höheren Daseinsebene, durch die sich Mensch und Tier von der Pflanze unterscheiden. Es ist die Ebene der Triebe und Emotionen. Im letzteren Begriff steckt das lateinische motio, Bewegung. Emotionen sind die Kräfte, die uns bewegen, und die Muskeln sind ihre Instrumente. Mit Hilfe der Muskeln können sich die Emotionen in unserem Körper ausdrücken. Der Spitzwegerich weist durch den muskelartigen Charakter der Blätter eine wesenhafte Beziehung zu stark bewegender Emotionalität auf. Stark bewegend unter anderem deshalb, weil sich die Blätter sehr dynamisch, wie Flammen aus der grundständigen Rosette erheben. Es ist einleuchtend, dass eine enge Wechselwirkung zwischen der emotionalen Ebene und den Lebenskräften besteht. Ein harmonisches, von ruhigen Rhythmen geprägtes emotionales Leben ohne extreme Gefühlsausbrüche ist der beste Garant für die Förderung der Lebenskräfte und damit der Gesundheit, während eine impulsive, heftige Emotionalität, die sich der massvollen Kontrolle durch die Vernunft entzieht, an den Lebenskräften zehrt und die Gesundheit ruiniert. Der Spitzwegerich ist nun ein Heilmittel bei Schwächezuständen, die durch die erwähnte heftige Emotionalität hervorgerufen werden. Solche Zustände sind dadurch gekennzeichnet, dass die bewegende Kraft der Emotionen nicht auf eine zielgerichtete Aktivität gerichtet werden kann, sondern sich in sich selbst erschöpft. Es fehlt gewissermassen die Durchlässigkeit für die Informationsübertragung an der Grenzfläche zwischen den Emotionen – dem Luftelement – und den Lebenskräften – dem Wasserelement. Der Spitzwegerich stellt diese fehlende Durchlässigkeit mit Hilfe seiner Schleimstoffe wieder her. Schleimstoffe sind Substanzen, die eine schützende und vermittelnde Funktion an den Grenzflächen der Organismen ausüben. Der Spitzwegerich ist ganz durchdrungen von Schleimstoffen. Blätter, Wurzeln und Samen der Pflanze enthalten Schleimstoffe. Auf der körperlichen Ebene sind sie für die reizmildernde Wirkung bei Bronchialkatarrh verantwortlich.
Es gibt noch weitere Zeichen, die den Bezug zur Schwächung von Lebenskräften anzeigen. In den Blättern ist Aucubin enthalten, das sich unter der Einwirkung eines Enzyms aus der Pflanze in einen antimikrobiell wirksamen Stoff verwandelt. Frisch gepresster Spitzwegerichsaft enthält einen hohen Gehalt an konservierenden Stoffen; indem das natürliche Aufkeimen von Mikroorganismen abgetötet wird, wird der Spitzwegerichsaft zeitweise dem Lebenskreislauf entzogen. Auch der pilzartige Geruch des Safts oder der wesenhaften Urtinktur weist in dieselbe Richtung, denn Pilze verdanken ihr Dasein dem Abbau anderer Lebensorganismen.
Übertragen auf das Wesen des Spitzwegerichs heisst dies, dass abbauende Kräfte aus der emotionalen Daseinsebene die Lebenskräfte zurückgedrängt haben. Dieser Befund wird auch aus einer weiteren Beobachtung deutlich, zu deren Verständnis etwas ausgeholt werden muss. Jeder Forscher, der viele Pflanzen und Tiere mit einem Stereomikroskop oder allenfalls mit einer stark vergrössernden botanischen Lupe untersucht hat, macht die Feststellung, dass zwischen pflanzlichen und tierischen Mikrostrukturen ein fundamentaler Unterschied in der Ästhetik besteht. Pflanzenteile sind bis ins kleinste Detail strukturiert und harmonisch gestaltet. Jeder Betrachter empfindet die Mikrostrukturen von Pflanzen (in 10- bis 100facher Vergrösserung) als wunderbar gestaltet und sehr schön. Jedes Pflanzenteilchen erweist sich als eine Harmonie im Kleinen und erfüllt unsere Seele mit Begeisterung und Freude.
Wie anders sind die Mikrostrukturen tierischer Organismen. Diesen fehlt, abgesehen von wenigen Ausnahmen (z. B. Schmetterlingsflügel und Vogelfedern), die harmonische Strukturierung bis ins Detail, und ihr Anblick bei mittlerer Vergrösserung ruft beim Betrachter, der nicht nur rein wissenschaftlich an sein Objekt herangeht, oft ein mehr oder weniger grosses Unbehagen – in vielen Fällen sogar Ekel – hervor. Woher kommt dieser grosse Unterschied zwischen pflanzlichen und tierischen Strukturen, warum sind tierische Organismen nicht bis in die kleinsten Strukturen harmonisch gestaltet? Welche Kräfte sind es, die die kleinsten Strukturen gestalten? Es sind vor allem die Lebenskräfte, diejenigen Kräfte also, die in den Pflanzen am stärksten wirken. Der Übergang von pflanzlichem zu tierischem Leben wird nur dadurch ermöglicht, dass ein Teil der Lebenskräfte durch die neu hinzukommenden emotionalen Kräfte zurückgedrängt wird. Die mikrostrukturierenden Lebenskräfte müssen also abgeschwächt werden, um überhaupt die Beweglichkeit des Tieres zu ermöglichen, deshalb erscheinen uns tierische Strukturen nicht vollendet und erregen oft Gefühle der Ablehnung. Die tierischen Kräfte wirken sich erst in den grösseren Strukturen harmonisch gestaltend aus. Erst die von blossem Auge erkennbaren Formen von Tier und Mensch empfinden wir als schön. Als ich zum erstenmal den Blütenstand des Spitzwegerichs in 20facher Vergrösserung im Stereomikroskop betrachtete, erschrak ich und war sehr befremdet. Was sich mir offenbarte, war nicht die harmonische Struktur eines pflanzlichen Organismus, sondern die eines tierischen. Insbesondere die stark behaarten Griffel, wie auch die trockenhäutigen Kelch- und Kronblätter haben eher einen insektenhaften als einen pflanzlichen Charakter. Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, dass beim Spitzwegerich Kräfte am Werk sind, die die harmonisch gestaltenden Lebenskräfte schwächen.
Als Letztes muss noch der starke Bezug des Spitzwegerichs zur Lunge erklärt werden. Die Lunge ist das Organ, durch das wir mit der Luft verbunden sind. Das Element Luft ist nun der Ebene der Emotionen zugeordnet, so wie das Wasser Träger der Lebenskräfte ist. Dies wird nicht zuletzt daraus ersichtlich, dass man emotionale Zustände oft durch Begriffe aus der Meteorologie zum Ausdruck bringt, während man im Zusammenhang mit den Lebenskräften von Wasser zum Beispiel vom Lebensquell spricht. Lunge und Herz sind die Organe mit dem stärksten emotionalen Bezug, wobei die Lunge den direkten, stofflichen Zugang hat, da sie die Luft, die Trägerin der emotionalen Kräfte, ein- und ausatmet. Die Lunge ist das Organ, das erst mit der Geburt eine Bedeutung erlangt (mit dem ersten Schrei), durch die wir in die Luft der Welt eintreten und zu einem emotional selbständigen Wesen werden. Es ist die wesenhafte Beziehung des Spitzwegerichs zur Emotionalität an sich, die gleichzeitig auch einen organischen Bezug zur Lunge herstellt, weshalb man bei dieser Heilpflanze von einem spezifischen Lungenmittel sprechen kann.»
Wesen
«Zwischen den Fingern zerriebene Spitzwegerichblätter haben eine schleimartige Konsistenz und weisen auf einen feuchten, kühlen Charakter hin. Als Standort sucht die Pflanze hingegen eher trockene Stellen. Der Spitzwegerich trägt somit das Prinzip der Feuchtigkeit ins Trockene. Seinem Wesen nach ist der Spitzwegerich – bildlich gesprochen – ein pflanzlicher «Feuerlöscher». Er wird angezogen von überhitzten, aufflammenden Prozessen, die er zu löschen und zu kühlen vermag. Man könnte sagen, er überzieht die Brandstellen mit einer kühlenden, schleimartigen Schicht, die sich befeuchtend und schützend über die Flächen legt. Natürlich handelt es sich hierbei nicht um konkretes Feuer, sondern um entzündliche Prozesse. Plantago hat einen kühlenden und heilenden Einfluss auf entzündliche Erkrankungen der Schleimhäute der Atemwege. Die Pflanze steht in einem wesenhaften Bezug zu den Amphibien, deren Haut immer feucht sein muss. Genauso wie diese Tiere an der Grenze zwischen Wasser und Luft leben, vermittelt der Spitzwegerich zwischen dem Wässrigen der Lebenskräfte und dem Luftigen des Lebensatems. Hierbei ist die Lunge das vermittelnde Organ, dessen Funktion der Spitzwegerich zu unterstützen vermag. Aufflammende Prozesse können auch im Seelischen in einer eruptiven Emotionalität gesehen werden. Der dem Spitzwegerich entsprechende Konstitutionstyp hat intensive Gefühle. Er ist ein Hitzkopf und fühlt sich schnell angegriffen. Schon das kleinste Fünkchen kann ein unkontrollierbares Feuer entfachen. Er explodiert und rastet aus, um später erschöpft nach Atem zu ringen. Solche Menschen können zu Entzündungen der Haut und der Schleimhäute, zu Atemproblemen und chronischer Bronchitis neigen. Der Spitzwegerich wirkt sowohl auf der seelischen als auch auf der körperlichen Ebene, indem er die überschießende, feurige Emotionalität kühlt und die entzündete Schleimhaut mit einer schützenden, antiseptischen Schicht überzieht. Dadurch lindert er die Reizzustände und begünstigt die Heilung.»
Botanik
Plantago lanceoalata L., der Spitzwegerich ist eine Pflanze, die weltweit vorkommt. Aus ihrer Pfahlwurzel treibt sie ihre lanzettlichen, wenig differenzierten, Blätter mit den parallel stehenden Nerven. Diese Parallelnervigkeit stellt eine Besonderheit dar. Die meisten zweikeimblättrigen Pflanzen, zu denen auch der Spitzwegerich gehört, weisen netznervige Blätter auf. Die, bis 30 cm lang werdenden, Blätter stehen in einer grundständigen Rosette zusammen. Aus dieser Rosette entspringt der kantige Ährenstiel, welcher bis zu 50 cm hoch wird und der den Blütenstand weit über den Blattbereich hinaushebt. Die Blüten-Ähre an seiner Spitze blüht kontinuierlich von unten nach oben ab. Die unscheinbaren Blüten, welche in dieser Ähre zusammenstehen, zeigen sich eigentlich nur durch die weisslichen Staubbeutel, die zur Reife weit aus den Blüten heraushängen. Ihnen fehlt jegliche Ausstrahlung, die man vielleicht von einer pflanzlichen Blüte erwarten würde. Vor allem die sich später bildenden Samen sind sehr schleimhaltig, aber auch die Blätter enthalten Schleimstoffe. Die Blätter der Pflanze entwickeln beim Zerreiben einen typischen Pilzgeruch.
Verwendung
Der weitverbreitete Spitzwegerich blickt in der Naturheilkunde auf eine lange Anwendungstradition im Bereich der Erkältungskrankheiten und Husten, Lungen- und Bronchialleiden zurück. Die entzündungshemmende und reizmildernde Wirkung des Spitzwegerich macht man sich zu Nutze bei innerlichen und äusserlichen entzündlichen Beschwerden der Schleimhäute und der Haut und auch bei chronischen Lungenerkrankungen.
Inhaltsstoffe
Typische Inhaltsstoffe für den Spitzwegerich, Plantago lanceolata L., sind (Schleim-)Polysaccharide und Iridoidglykoside. Des Weiteren findet man phenolische Verbindungen, wie Flavonoide und Phenolcarbonsäuren, sowie Gerbstoffe.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- Wichtl, M. et al. Teedrogen und Phytopharmaka. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 1997).
- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Community herbal monograph on Plantago lanceolata L ., folium. EMA/HMPC/437858/2010 Corr. (2014).
- BGA/BfArM (Kommission E). Plantaginis lanceolatae herba (Spitzwegerichkraut). Bundesanzeiger 223, (1985).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2014).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil


STEINKLEE
Melilotus officinalis (L.) LAM
WESEN: Erweichen, lösen, beruhigen, erwärmen
Wesen und Signatur
Signatur
«Der Steinklee gehört zur Familie der Leguminosen (Schmetterlingsblütler) und kommt an trockenen, steinigen Standorten wie Kiesgruben, Schuttplätzen und Wegrändern vor. Er wird bis zu 90 cm hoch. Die Blätter sind dreizählig zusammengesetzt, und die kleinen gelben Blüten stehen zu 30 bis 70 in Trauben. Der Steinklee macht in seiner Gesamtgestalt einen äusserst aufgelösten Eindruck: die unzähligen kleinen Blüten, die ausserdem rasch ihre gelbe Farbe verlieren und verblassen, die unzähligen kleinen Blätter und die stark verzweigten Stengel. Gewiss gibt es auch viele andere Pflanzen mit sehr kleinen Blüten, aber dann ist die ganze Pflanze klein. Oder es gibt andere Pflanzen, die sehr viele Blätter und Blüten haben, aber dann ist die ganze Pflanze gross, wie beispielsweise Bäume. Es gibt kaum andere Pflanzen, die eine recht stattliche Grösse erreichten und doch so kleine Blüten und so viele Blätter haben. Ein weiteres Zeichen der Auflösung ist die bemerkenswerte Tatsache, dass der Steinklee im zweiten Jahr kleinere Blätter als im ersten Jahr macht und dass die Blüten kurz nach dem Erblühen ihren gelben Farbstoff auflösen und verblassen.
Um aber das wichtigste Kennzeichen des auflösenden Wesens erklären zu können, müssen einige Kenntnisse über die chemischen Inhaltsstoffe des Steinklees vermittelt werden. Die Pflanze hat einen hohen Gehalt an Cumarin und dessen Glykosid. Cumarine sind flüchtige Stoffe mit intensivem Geruch. Es sind zum Beispiel Cumarine, die den typischen Geruch von frischem Heu bewirken. Nun wissen wir alle, dass Heu ganz anders als frisches Gras riecht. Dies lässt auf einen chemischen Umwandlungsprozess während des Trocknens schliessen. Es handelt sich dabei um die Bildung der riechenden Cumarine aus einer geruchlosen Vorstufe, den Cumaringlykosiden. Dabei handelt es sich um Verbindungen, die aus einem Cumarinmolekül und einem Zuckermolekül zusammengesetzt sind. Beim Verwelkungsprozess werden Enzyme (Glykosidasen) freigesetzt, die den Zucker aus den Cumaringlykosiden abspalten und das Cumarin freisetzen. Diese Abspaltung ist also eine teilweise chemische Auflösung. Die meisten Pflanzen, die Cumaringlykoside enthalten, wie die Gräser, riechen im frischen Zustand überhaupt nicht nach Cumarin, enthalten also kein freies Cumarin, sondern nur dessen geruchloses Glykosid.
Ganz anders verhält es sich beim Steinklee. Diese Pflanze hat bereits im frischen Stadium einen intensiven Geruch nach Cumarin (nach frischem Heu). Das heisst, der Auflösungsprozess, der normalerweise erst beim Welken einsetzt, ergreift diese Pflanze bereits im Blütenstadium. Zu erwähnen ist auch, dass Cumarin an sich schon eine Substanz ist, die das Prinzip des Lösens verkörpert. Cumarin erniedrigt die Blutviskosität, es verflüssigt das Blut. Die wichtigsten Medikamente zur Blütverdünnung, die etwa nach Embolien ärztlich verordnet werden, sind chemische Derivate aus Cumarin. Wir sehen also, dass der Steinklee durch einen Auflösungsprozess bereits im frischen Stadium eine Substanz bildet, die eine lösende Wirkung besitzt. Dies ist, wie gesagt, eine Ausnahme und damit ein sehr starker Hinweis auf die bereits mehrfach erwähnte Wesenskraft dieser Pflanze.»
Wesen
«Der Steinklee entwickelt einen kräftigen Duft nach frischem Heu, gemischt mit einer leichten Honignote. In dieser Komposition offenbart sich die Pflanze sehr direkt und unverhüllt. Im Bann ihres Duftes fühlen wir uns wohlig entspannt und angenehm beruhigt.
Erinnern wir uns an einen heißen, schwülen Sommertag! Der Atem geht schwer, jede Bewegung ist anstrengend in der Hitze, wir fühlen uns matt und energielos, es liegt Spannung in der Luft, die Atmosphäre ist «elektrisch». Dann bricht ein reinigendes Sommergewitter herein, und kurz darauf breitet sich eine erlösende Entspannung aus, wir können wiederfrei atmen. Die Luft riecht frisch und rein, die Atmosphäre hat sich entladen, die Temperatur ist wieder angenehm. Dieses und ähnliche Bilder lässt der Steinklee aufkommen; es ist die ins Bild übersetzte Wirkung der Pflanze.
Der Steinklee hat ein lösendes Wesen, er lässt die trägen, verlangsamten Lebenssäfte wieder fließen. Wenn Verklumpungs- und Stautendenzen in Seele und Körper auftreten, wirkt Steinklee erweichend und auflösend. Er hat eine spezifische Wirkung auf die Blutviskosität und verbessert, verflüssigt gewissermaßen durch ungesunde Lebensweise verdicktes Blut. Durch seine lösende Kraft wirkt der Steinklee auch entspannend und beruhigend.»
Botanik
Der Gewöhnliche Steinklee, Melilotus officinalis (L.) LAM, ist eine zweijährige bis zu 200 cm hoch werdende Pflanze. Er gehört zur Familie der Schmetterlingsblütler (Fabaceae). Aus einer verzweigten Pfahlwurzel wachsen im zweiten Jahr viele aufrechte, kantige und derbe Stängel. Die Blätter der Pflanze sind dreizählig. Ihre Teilblätter sind breit-lanzettlich bis verkehrt-eiförmig und am Rande gesägt. Die Blätter sind relativ klein im Verhältnis zur Gesamtgrösse der Pflanze. Betrachtet man einen Gewöhnlichen Steinklee aus der Distanz, nimmt man sie gar nicht so recht wahr, denn die kleinen Blätter stehen auch nur zerstreut an der Pflanze. Im zweiten Standjahr blüht der Steinklee zwischen Mai und September mit kleinen, gelben, später oft rasch verblassenden Blüten. Diese stehen achselständig in 4 bis 10 cm langen Trauben und sind sehr zahlreich. Je Traube sind 30 bis 70 Blüten vorhanden. Die Blüten selbst haben die typische Form einer Schmetterlingsblüte und bestehen aus den drei Teilen Fahne, Flügel und Schiffchen. Da die Blüten einer Traube nach und nach Aufblühen finden sich so während der Blütezeit die drei Stadien Knospen, offene Blüten und heranreifende Früchte gemeinsam an einer Traube. Auffallend beim Gewöhnlichen Steinklee ist der intensive Duft, den er verströmt. Wir kennen den Geruch von Waldmeister und frisch geschnittenem Gras, wenn sie trocknen, es ist der Duft nach Cumarin.
Verwendung
Der Steinklee, Melilotus officinalis (L.) LAM, ist wie die Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) eine bekannte Venenpflanze, die nicht nur innerlich, sondern auch äußerliche in Form von Salben und Suppositorien bei Beschwerden der chronisch venösen Insuffizienz angewendet wird. Der Pflanze wird durch Förderung des venösen Rückflusses und verbesserter Lymphkinetik eine antiödematöse, und wundheilungsfördernde Wirkung zugeschrieben. Zu den Anwendungsgebieten gehören Krampfaderleiden, Schwellungen, Schmerzen und Schweregefühl in den Beinen, Hämorrhoiden, sowie Prellungen, Verstauchungen und oberflächliche Blutergüsse. Verdorbener Steinklee im Heu führt, an Tiere verfüttert, zu schwerer Blutungsneigung. Verantwortlich dafür ist, wie man später herausgefunden hat, die Bildung von Dicumarol durch Schimmelpilzbefall. Die Entdeckung dieses (im Steinklee nativ nicht vorhandenen) Stoffes, führte zu der Entwicklung der heutigen synthetische Vitamin-K-Antagonisten deren blutgerinnende Effekte in der Medizin und auch in Rhodentiziden genutzt wird.
Inhaltsstoffe
Der Steinklee, Melilotus officinalis (L.) LAM, riecht charakteristisch nach frischem Heu. Verantwortlich hierfür sind verschiedene Cumarine wie das Melilotin. Darüber hinaus findet man phenolische Säuren (z.B. Cumarsäure, Melilotosid), Flavonoide und Triterpensaponine, wie z.B. das Melilotigenin.
Referenzen
- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).
- BGA/BfArM (Kommission E). Meliloti herba (Steinkleekraut). Bundesanzeiger 50, (1986).
- Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment report on Melilotus officinalis ( L .) Lam ., herba. EMA/HMPC/44165/2016 (2017).
- BGA/BfArM (Kommission D). Melilotus officinalis. Bundesanzeiger 29 a, (1986).
- Stahmann, M. A., Huebner, C. F. & Link, K. P. Studies on the Hemorrhagic Sweet Clover Disease. J Biol Chem 138, 513–527 (1941).
- Bye, A. & King, H. K. The Biosynthesis of 4-Hydroxycoumarin and Dicoumarol by Aspergillus fumigatus Fresenius. Biochem J 117, 237–245 (1970).
- Kalbermatten, R. & Kalbermatten, H. Pflanzliche Urtinkturen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2018).
- Kalbermatten, R. Wesen und Signatur der Heilpflanzen. (AT Verlag, Aarau, Schweiz, 2016).
Bilder: Ceres Heilmittel AG, Kesswil

























































































































































